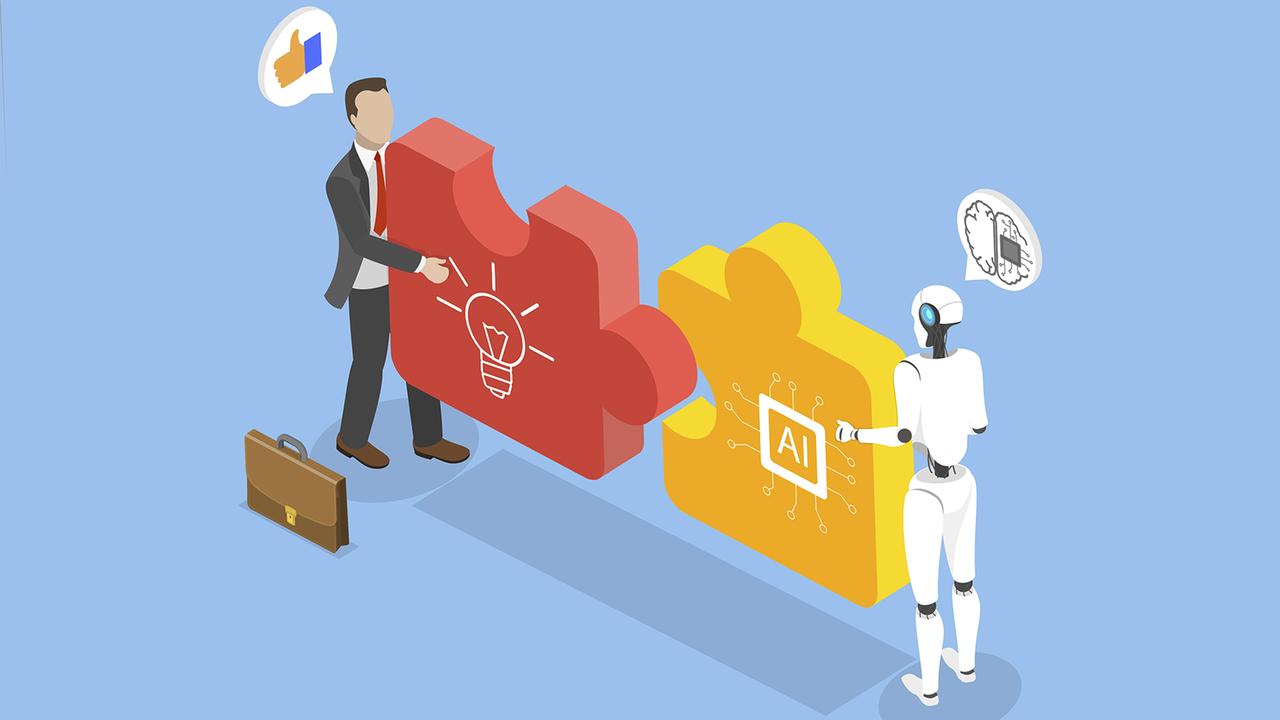Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie der Zukunft – doch zwischen Forschung und Anwendung klafft in Deutschland noch immer eine Lücke. Beim AI Grid Summit diskutieren Forschende, wie der Transfer von der Uni in die Wirtschaft gelingen kann. Von Efthymis Angeloudis
Sie ist eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien für die digitale Transformation von Wirtschaft und Industrie. In vielen deutschen Unternehmen wird Künstliche Intelligenz (KI) bereits in Pilotprojekten oder einzelnen Prozessschritten eingesetzt, doch flächendeckende Anwendungen besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen stehen oft noch aus.
„Deutschland darf KI nicht auf Chatbots oder Sprachmodelle reduzieren. Unsere Stärke liegt in der industriellen KI – dort, wo Ingenieurskunst und Präzision zählen,“ sagt Wolfgang Wahlster, Vorsitzender des AI Grid und Mitbegründer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) gegenüber rbb|24 auf der AI Grid Summit in Berlin. „Bei den größeren Mittelständlern ab 250 Beschäftigten haben bereits rund die Hälfte KI-Anwendungen im Einsatz – vom Vertrieb bis zur Logistik und Produktion.“ Auch bei Start-ups sei der KI-Einsatz sehr weit verbreitet, so Wahlster. „Aber im Mittelfeld ist noch viel Luft nach oben.“

So steht es um KI in Berlin und Brandenburg
Neue KI-Anbieter wie das chinesische „Deepseek“ fordern das Silicon Valley heraus. Auch in Berlin und Brandenburg wird KI erforscht und entwickelt. Ob die Technologie aber in mittelständischen Unternehmen erfolgreich sein wird, ist umstritten. Von Julian von Bülowmehr
KI – nur ein vorübergehender Hype?
Eine Bitkom-Studie vom März dieses Jahres gibt Wahlster recht. Zwar nutzen 42 Prozent der Industrieunternehmen bereits KI-Anwendungen – etwa für Qualitätsprüfung, Fertigungsplanung oder Logistikoptimierung. Und weitere 35 Prozent planen den Einsatz. Doch fast die Hälfte fürchtet, dass Deutschland die „KI-Revolution“ verschläft. Ein Fünftel der Unternehmen glaubt sogar, KI sei nur ein vorübergehender Hype.
Als Gegenmittel fordert Wahlster KI aus der Forschung in konkrete Produkte und Produktionsprozesse zu bringen. „Wir können die alten Modelle nicht immer wieder auf den Markt bringen. Wir müssen KI in unsere Produkte injizieren – vom Miele-Herd bis zum Erntemaschinenroboter.“
Bei solchen hochpräzisen, hochqualitativen Systemen, die auch in kleineren Losgrößen produziert werden, sei Deutschland immer noch Marktführer. Um das zu halten und weiter auszubauen, benötige es auch hochqualifiziertes Personal. „Und das muss auch in die Köpfe rein“, sagt Wahlster dem rbb.
Wolfgang Wahlster, Mitbegründer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz
Transferlücke zwischen Forschung und Wirtschaft
Genau hier setzt das vom Bundesforschungsministerium geförderte AI-Grid-Netzwerk an. Es will den Austausch zwischen Forschung, Industrie und Start-ups intensivieren und junge Forschende gezielt auf eine Karriere jenseits der Universität vorbereiten. Beim AI Grid Summit 2025 im Einstein Center Digital Future in Berlin kamen mehr als 90 Expertinnen und Experten zusammen, um Wege aus der Transferlücke zu diskutieren.
Laure Poirson, Projektleiterin des Netzwerks, erlebt die Lücke im Alltag: „Viele promovierte KI-Forschende sind absolute Expert:innen in ihrem Gebiet, aber im Unternehmen gibt es ganz viele andere sehr komplexe Probleme und Herausforderungen zu meistern und da gibt es vielleicht einige Skills, die sie noch nicht haben.“ AI Grid wolle sie dabei unterstützen, die wissenschaftliche Tiefe in die Wirtschaft zu tragen – wo sie dringend gebraucht werde.
Und Bedarf gebe es an jungen Forschenden allemal. „Data Scientists sind sehr gesucht, aber es gibt gerade nicht genug Talente“, sagt Poirson. „Unser Ziel ist, junge Leute zu ermutigen, in diese Disziplin zu gehen und das nicht nur in der Informatik, sondern auch in angrenzenden Bereichen wie Biologie, Neurowissenschaft oder Linguistik.“
Hilfe! Wie gründe ich ein Startup?
Gründungszentren in München, Paris oder Brüssel begleiten Startups Schritt für Schritt bis zur Marktreife. In Berlin hingegen fehlt ein zentraler Anlaufpunkt. Doch gerade bei KI-Gründungen scheint sich jetzt etwas zu tun. Von Efthymis Angeloudismehr
Auch als Quereinsteiger in die KI-Forschung
Dass der Einstieg in die KI-Branche nicht nur Tech-Experten vorbehalten ist, zeigt die Linguistin Judith Knoblach von der Uni Bamberg. „Ich komme aus der Sprachwissenschaft und habe mir das Programmieren selbst beigebracht,“ erzählt sie. Heute forscht sie daran, wie KI in kleinen und mittleren Unternehmen eingesetzt werden kann – etwa bei der akustischen Analyse von Produktionsdaten. „KI ist ein interdisziplinäres Feld. Es braucht psychologisches, sprachliches und technisches Wissen.“
Auch Nachwuchsforscher Vivek Chavan von der TU Berlin sieht im industriellen Einsatz von KI ein Feld voller Möglichkeiten. In seiner Arbeit verbindet er Computer Vision mit Robotik, um Produktionsfehler zu erkennen und Prozesse zu optimieren. Doch auch er denkt schon an das eigene Unternehmen, wie er erzählt: „Ich würde gern gründen – Berlin ist dafür ein großartiger Ort. Die Szene ist kollaborativ und offen.“ Dennoch sieht Chavan Hürden: „Es gibt gute Strukturen für Startups, aber beim Skalieren [Anm. d. Red. dem Ausbau des Unternehmens] wird es schwierig. Viele müssen dann in die USA oder nach Asien gehen.“

Sam Altman in Berlin: „Nutzt KI, um nicht abgehängt zu werden“
Nach dem Schock durch den Erfolg des chinesischen KI-Startups Deepseek ist OpenAI-Chef Sam Altman an der TU Berlin. Hier will er mit gleich zwei Neuigkeiten punkten: Einer neuen Version von ChatGPT und einem Büro in Deutschland. Von Efthymis Angeloudismehr
Aus der Theorie in die Praxis
Dass diese Nachricht auch in der Politik angekommen ist, zeigen die Aussagen von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) in einem Interview mit Reuters: „Aktuell sind wir überwiegend Kunde. Wir müssen stärker zum Entwickler und Anbieter werden.“ Wildberger räumt ein, dass US-Firmen bei KI-Basismodellen weit voraus seien, warnt jedoch vor einer zu defensiven Haltung. „Im Vergleich zu den USA müssen wir natürlich noch stärker wachsen – aber wir haben schon eine hohe Dynamik.“ Und KI sei dafür, so Wildberger, „eine große Chance“ und eröffne „ein riesiges Wachstumsfeld“.
Eine Möglichkeit zu wachsen sind laut Wahlster auch internationale Partnerschaften. So unterzeichnete das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dessen Chefberater Wahlster ist, im September 2024 eine Vereinbarung mit dem Taiwan AI Center of Excellence (AICoE). Die Zusammenarbeit soll sich insbesondere auf vertrauenswürdige KI, Agrarrobotik und Halbleitertechnologie konzentrieren.
Der Zeitpunkt ist günstig: 2027 will der taiwanesische Chip-Riese TSMC gemeinsam mit europäischen Partnern im Norden von Dresden die Halbleiter-Produktion aufnehmen. Eine Chance aus Theorie Praxis zu machen.