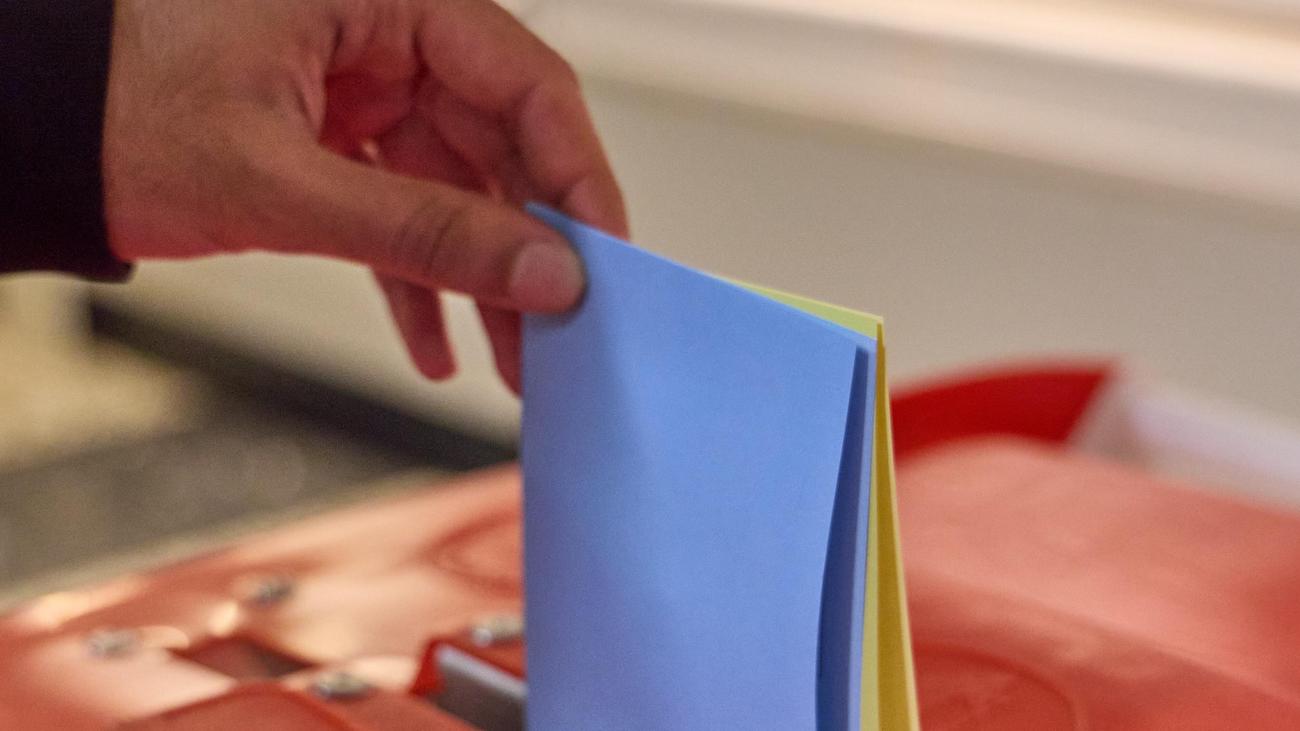Liebe
Leserin, lieber Leser,
Hamburg hat abgestimmt – über zwei große Ideen, die
verschiedene Themen, aber ähnliche Fragen berühren: Wie wollen wir in Zukunft
leben, wie viel Veränderung trauen wir uns zu, wie verstehen wir Verantwortung?
Spannend war es gestern Abend, das Ergebnis ziemlich knapp. Jetzt steht fest:
Der Zukunftsentscheid zum Klima war erfolgreich. Hamburg soll schon 2040
klimaneutral werden, nicht erst 2045. Gescheitert ist dagegen der zweite
Volksentscheid zu der Frage, ob Hamburg das bedingungslose Grundeinkommen in einem
Modellprojekt testen soll.
Mein Kollege Frank Drieschner war auf der Wahlparty der
Initiative „Zukunftsentscheid“, die ihren Triumph, wie er erzählte,
„professionell und regelrecht zurückhaltend inszeniert“ habe. Die Feier im Café
Schöne Aussicht in Planten un Blomen habe an eine U-30-Party erinnert, graue
Haare waren kaum zu sehen. Anfangs war die Stimmung angespannt; selbst als um
20.16 Uhr das nötige Quorum von 263.000 Ja-Stimmen erreicht war und der Vorsprung
weiter wuchs, warnten die Sprecherinnen Annika Rittmann und Lou Töllner noch:
„Es ist noch nicht vorbei!“ Erst als die FDP online bereits vor einem „Kollaps
auf Ansage“ warnte, begann die Initiative zu jubeln. „In den letzten Wochen,
Monaten und Jahren haben wir alles gegeben“, sagte Annika Rittmann. „Wir haben
gezeigt, dass sich die Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger einen sozialen
und ambitionierten Klimaschutz wünscht – und ein Gesetz verabschiedet, das
diesen Wunsch Wirklichkeit werden lässt.“
Auch in der Kampstraße im Schanzenviertel, wo die
Initiative „Hamburg testet Grundeinkommen“ zum Wahlabend geladen hatte, war die
Stimmung zunächst ausgelassen. Mein Kollege Christoph Twickel war dort. Als um
18.40 Uhr die Wahlbeteiligung bekanntgegeben wurde – 43 Prozent! – brach Jubel
aus, erzählte er. Dann verfolgten alle gebannt die Balkendiagramme auf wahlen-hamburg.de –
doch die Richtung war früh klar: Zuspruch fand die Idee des Grundeinkommens vor
allem in den inneren Stadtvierteln, auf St. Pauli, der Veddel, in der Neustadt und in Teilen
Wilhelmsburgs. In den äußeren Bezirken hingegen nahm die Zustimmung spürbar ab
– je weiter vom Zentrum, desto größer die Skepsis. Warum diese Initiative
scheiterte? „Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass unser Vorschlag etwas
kompliziert ist“, sagte ein Aktivist. Einer der zentralen Begriffe des
Gesetzentwurfs lautet „negative Einkommenssteuer“ – ein Konzept, mit dem viele
vermutlich wenig anfangen konnten.
© ZON
Newsletter
Elbvertiefung – Der tägliche Newsletter für Hamburg
Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt.
Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement.
Der Zukunftsentscheid dagegen sendet ein starkes Signal,
weit über Hamburg hinaus. Die Menschen wollen Klimaschutz und sie wollen Tempo,
trotz – oder gerade weil – sich auf Bundesebene ein klimapolitischer
Rückschritt abzeichnet. Jetzt liegt der Ball beim Senat. Die Umsetzung des
Klimaentscheids wird ein Kraftakt, sicher. Für die Wirtschaft, die Verwaltung, für uns
alle. Und es ist mit Widerstand zu rechnen, wie das knappe Ergebnis zeigt. Umso
wichtiger sind nun klare und verlässliche politische Signale. Die Politik muss
den Auftrag ernst nehmen – und zeigen, dass Hamburg bereit ist, Verantwortung
zu tragen.
Eine ausführliche Einordnung des Zukunftsentscheids lesen Sie hier in der Analyse von Florian Zinnecker.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!
Ihre
Annika Lasarzik
Wollen Sie uns Ihre
Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie
uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de.
WAS HEUTE WICHTIG IST
© Georg Wendt/dpa
Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und Nils Weiland bleiben an der Spitze
der SPD Hamburg. Auf dem Landesparteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg
erhielten sie 89,8 beziehungsweise 78,6 Prozent der Stimmen – etwas weniger als
bei ihrer Wiederwahl 2023. Auch die drei Stellvertreterinnen und Stellvertreter
– Schulsenatorin Ksenija Bekeris sowie die Bürgerschaftsabgeordneten Mithat
Çapar und Alexander Mohrenberg – bleiben in ihren Ämtern.
Rund 800 Menschen haben in Hamburg mit einer Mahnwache an die tödlich
verunglückte Radfahrerin Wanda Perdelwitz erinnert. Am Unfallort an der
Verbindungsbahn in Rotherbaum stellten sie Kerzen auf und schmückten ein weißes
Geisterrad mit Blumen. Der ADFC Hamburg hatte zu der Kundgebung aufgerufen, um
ein Zeichen gegen gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu setzen. Perdelwitz
starb bei einem sogenannten Dooring-Unfall – mehr dazu heute im Thema des
Tages.
Der neue Fern- und Regionalbahnhof Hamburg-Altona am Diebsteich soll
erst Ende 2029 und damit zwei Jahre später als geplant in Betrieb gehen. Grund
sind Bauverzögerungen durch Schadstoffe und Komplikationen am Kreuzungsbauwerk
Langenfelde, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Bis zur Verlegung läuft der Verkehr
für Fahrgäste weiter wie gewohnt über den bestehenden Bahnhof Altona.
In aller Kürze
• Werder Bremen hat am Samstagabend das Nordderby
der Frauen-Bundesliga gegen den HSV mit 2:0 gewonnen, dank zweier
verwandelter Elfmeter von Werder-Stürmerin Larissa Mühlhaus • Nach rund
einem Jahr Bauzeit ist die Umgestaltung des Neuen Jungfernstiegs
abgeschlossen – die Straße an der Binnenalster bietet nun mehr Platz für
Fußgänger und Außengastronomie, für Autos gilt Tempo 20, rund 50 Parkplätze
wurden abgeschafft • Mit einem Senatsempfang im Rathaus eröffnet
Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal heute Abend die Hamburger Horizonte
2025 zum Thema „Über Wasser“ – bei dem Debattenformat diskutieren
Forschende und prominente Gäste über wissenschaftliche Erkenntnisse und deren
Bedeutung für die Gesellschaft
THEMA DES TAGES
© Marcus Brandt/dpa
„Als Radfahrer hat man da kaum eine Chance“
Der Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz hat
Hamburg erschüttert. Die 41-Jährige, bekannt aus der TV-Serie „Großstadtrevier“,
starb am 6. Oktober an den Folgen eines Fahrradunfalls – ein sogenannter
Dooring-Unfall, bei dem Radfahrer gegen plötzlich geöffnete Autotüren prallen.
Der Crash ereignete sich am 28. September nahe dem Bahnhof Dammtor. Solche
Unfälle sind vermeidbar, sagen Experten seit Jahren. ZEIT-Redakteurin Annika
Lasarzik hat mit Kirstin Zeidler von der Unfallforschung der Versicherer (UDV)
darüber gesprochen, warum die Gefahr unterschätzt wird – und was helfen könnte,
solche Unfälle zu verhindern.
DIE ZEIT: Frau Zeidler, was ging Ihnen durch den Kopf, als
Sie vom Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz hörten?
Kirstin Zeidler: Es ist immer wieder erschütternd, wenn man von so einem
Fall hört. Besonders, weil es Situationen sind, die wohl jeder von uns kennt –
jemand steigt kurz aus, ein Radfahrer kommt vorbei. Leider sind Dooring-Unfälle
in Deutschland schon lange ein unterschätztes Problem.
ZEIT: Sie haben das Phänomen 2020 in einem großen Forschungsprojekt untersucht.
Wie oft kommt es zu diesen Unfällen?
Zeidler: Um die aktuelle Entwicklung zu beurteilen, fehlen Zahlen. Dooring-Unfälle
werden nicht gesondert erfasst. Wir haben damals untersucht, welches Risiko
generell von geparkten Autos ausgeht, und dafür die Beschreibung von mehr als
27.000 Unfällen aus Polizeistatistiken ausgewertet. Fast jeder fünfte Unfall,
bei dem Radfahrende oder Fußgänger verletzt wurden, stand im Zusammenhang mit
parkenden Autos. Das sogenannte Dooring – also das unachtsame Öffnen einer
Autotür – war mit Abstand das häufigste Problem für Radfahrende, es machte mehr
als die Hälfte dieser Rad-Unfälle aus. Wie hoch dieser Anteil war, hat uns
selbst überrascht.
ZEIT: Warum kommt es zu den Unfällen?
Zeidler: Mir ist wichtig zu sagen, dass ich den konkreten Fall aus Hamburg nicht kommentieren möchte –
aus Rücksicht auf die Angehörigen und weil die polizeilichen Ermittlungen noch
laufen. Grundsätzlich wissen wir aus der Forschung, dass sich an der
Infrastruktur noch viel verbessern ließe, um solche Unfälle zu vermeiden. Viele
Verkehrsteilnehmende unterschätzen das Risiko: Man hält kurz am Straßenrand,
ist in Gedanken, fühlt sich sicher – und genau dann passiert es. Oft reicht
schon ein Moment der Unachtsamkeit. Hier braucht es mehr Aufklärung und
Bewusstsein.
ZEIT: Lassen Sie uns da ins Detail gehen. Was raten
Sie Autofahrern?
Zeidler: Eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Maßnahme ist der sogenannte
holländische Griff. Dabei öffnet man die Tür mit der jeweils anderen Hand – als
Fahrer also mit rechts, als Beifahrer mit links. Dadurch dreht sich automatisch
der Oberkörper, der Blick geht nach hinten, in Richtung Fahrbahn oder Radweg.
Rück- und Seitenspiegel zeigen nur einen Teil des Straßenraums. Viele
unterschätzen, wie wenig Zeit Radfahrende haben, um zu reagieren: Wer mit 20
km/h fährt, braucht rund elf Meter, um zum Stillstand zu kommen – und das
Gehirn etwa eine Sekunde, um überhaupt zu reagieren. Bei Pedelecs, die bis zu
25 km/h erreichen, ist der Bremsweg entsprechend länger.
ZEIT: Wie können sich Radfahrende schützen?
Zeidler: In vielen der von uns untersuchten Fälle kam es zu schweren
Kopfverletzungen. Ein Helm kann das Risiko deutlich verringern. Deshalb gilt:
besser immer tragen, auch auf kurzen Strecken. Außerdem empfehlen wir,
aufmerksam zu bleiben – also zu schauen, ob in parkenden Autos Personen sitzen
– und, wenn möglich, einen Meter Abstand zu halten.
ZEIT: An vielen Stellen im Stadtverkehr ist der Platz dafür aber gar nicht da.
Viele Radwege verlaufen direkt neben der Fahrbahn oder eingezwängt zwischen
Parkstreifen und Fußwegen.
Wie Städte den nötigen Platz für ausreichend große
Sicherheitsabstände schaffen und welche weiteren Maßnahmen zum Schutz vor Dooring
helfen könnten, lesen Sie weiter in der ungekürzten Fassung des Interviews auf zeit.de.
DER SATZ
© Carmen Palma/DIE ZEIT
„Der
Kebab-Burger hingegen verheißt nicht nur doppelten Genuss, sondern auch doppelt
so viel von dem, was die Gesundheitsapostel verdammen.“
Eine weltweit bekannte Burgerkette macht sich in
Deutschland lokale Fast-Food-Vorlieben zu eigen und kreiert eine Mischung aus
Burger und Döner. Ob diese Fusion gelungen ist? Der
ZEIT-Restaurantkritiker Michael Allmaier hat reingebissen.
DARAUF KÖNNEN SIE SICH FREUEN
Das Heine-Haus
Hamburg lädt anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums ein zu „Zu Gast bei Salomon Heine“. Die Schauspieler
Barbara Auer und Hans Löw führen ein literarisch-musikalisches Tischgespräch,
eigens für diesen Anlass verfasst von Christian Liedtke. Musikalisch begleiten
Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara Schumann und Gioachino Rossini
den Abend.
„Zu Gast bei Salomon Heine“, 16.10., 18 Uhr; Hamburger Kunsthalle/Werner-Otto-Saal,
Glockengießerwall 5
MEINE STADT
Barmbeker Kontraste an einem Herbstmorgen © Jörn Bullwinkel
HAMBURGER SCHNACK
Samstagabend in der U1. Drei Frauen um die dreißig waren
offenbar touristisch in Hamburg unterwegs. Eine zu den anderen: „Habt ihr auch
schon Likes?“ Eine Freundin: „Um welche App geht’s jetzt?“
Gehört
von Wiebke Nielsen
Das war die Elbvertiefung, der tägliche
Hamburg-Newsletter der ZEIT. Wenn Sie möchten, dass er täglich um 6 Uhr in
Ihrem Postfach landet, können Sie ihn hier
kostenlos abonnieren.