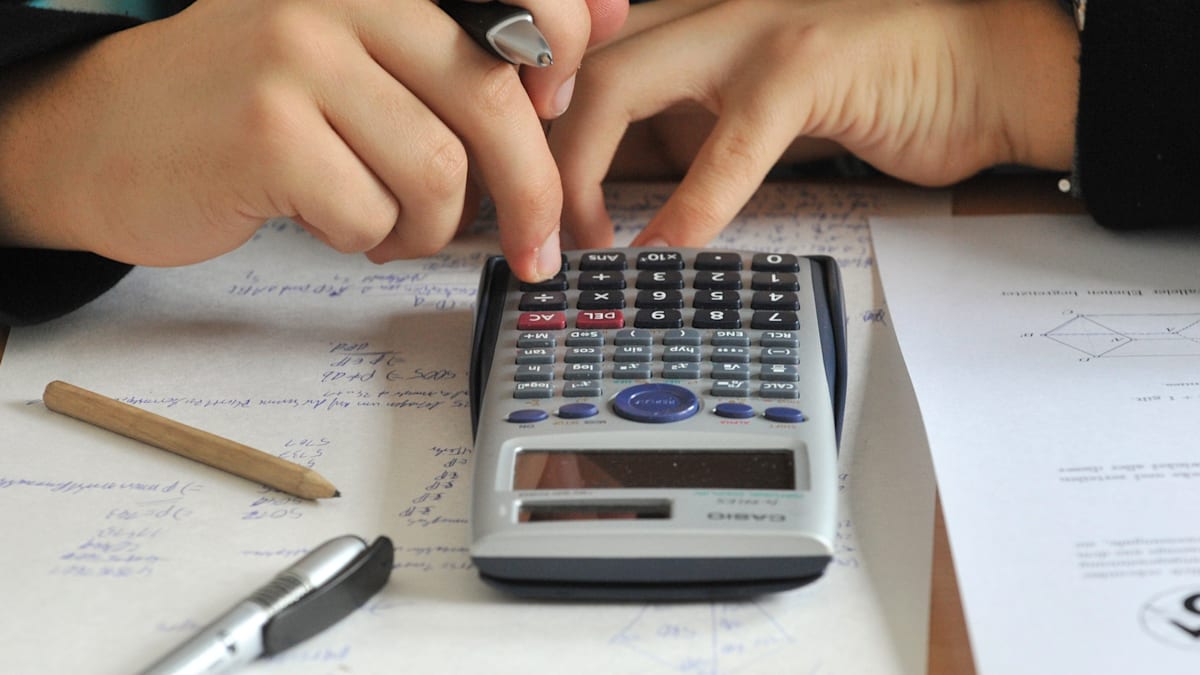Der neue IQB-Bildungstrend zeigt: Neuntklässler in Deutschland schneiden deutlich schlechter ab als 2018. Hamburg hält das Niveau und steigt im Mathe-Ranking auf Platz 4. Doch auch hier gibt es Verluste – und große Herausforderungen etwa bei der Motivation.
Während bundesweit die Leistungen von Neuntklässlern in Mathematik und den Naturwissenschaften seit 2018 deutlich eingebrochen sind, konnte die Hansestadt ihre Ergebnisse stabil halten und sich im Ländervergleich verbessern. Das geht aus dem neuen IQB-Bildungstrend hervor, den das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) erstellt hat. Doch die Zahlen sind aus Hamburger Sicht mit Vorsicht zu genießen.
Die Studie basiert auf einer repräsentativen Stichprobe von 48.279 Schülern der 9. Jahrgangsstufe an 1.556 Schulen. In Hamburg nahmen mehr als 3000 Neuntklässler von 113 Schulen teil. Das IQB überprüft, ob die von der KMK festgelegten Bildungsstandards erreicht werden. Für Mathematik und die Naturwissenschaften gab es die Studie schon 2012 und 2018.
Das Ergebnis diesmal: ein flächendeckender Leistungsabfall im Vergleich zu den Testungen von vor sechs Jahren. Der mittlere Kompetenzwert sank in Mathematik und Biologie um jeweils 24 Punkte, in Physik und Chemie um 23 Punkte – auf einer Skala, die 2012 mit einem Mittelwert von 500 normiert wurde. Kein Bundesland konnte sich dem Trend vollständig entziehen. Auch Hamburg nicht, aber die Ergebnisse fallen deutlich weniger negativ aus.
Die Hansestadt konnte ihre Ergebnisse in allen getesteten Bereichen weitgehend stabil halten. In Mathematik sank der Mittelwert nur um sechs Punkte auf 482 – der geringste Rückgang aller Länder. Damit kletterte Hamburg im Ranking von Platz 11 (2018) auf Platz 4. In den Naturwissenschaften verbesserte sich die Stadt im Schnitt von Rang 15 auf Rang 9.
„Insgesamt ist das Abschneiden der Hamburger Schüler im bundesweiten Vergleich sehr erfreulich. Die vielen Maßnahmen, die wir seit dem letzten IQB-Bildungstrend 2018 eingeführt und umgesetzt haben, haben Wirkung gezeigt. Hamburg gehört jetzt auch in Mathematik bundesweit zur Spitzengruppe“, sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Sie fügte aber auch hinzu: „Der deutschlandweite Trend ist besorgniserregend.“
Besseres Sprachverständnis hilft auch in Mathematik
Sie verwies auf die „Mathematikoffensive“ ab 2015: mehr Unterrichtsstunden, strengere Qualifikationsanforderungen für Lehrkräfte, überarbeitete Curricula. Ein Schwerpunkt der aktuellen Maßnahmen liegt auf der Sprachbildung als integrativem Bestandteil des Unterrichts. Fachsprachliche Kompetenzen gelten als Schlüssel zum Verständnis komplexer mathematisch-naturwissenschaftlicher Inhalte. In den Kerncurricula werden sie deshalb fächerübergreifend berücksichtigt.
Tatsächlich zeigt die IQB-Analyse: Jugendliche mit Zuwanderungshintergrund schneiden im Schnitt deutlich schlechter ab, vor allem in der ersten Generation. Unterschiede im sozioökonomischen Status und in den Deutschkenntnissen erklären einen großen Teil dieser Lücke. Hamburg steuert hier seit Jahren gegen – teils mit Erfolg, wie auch Bekeris am Donnerstag betonte.
Die Reformen der letzten Jahre insgesamt hätten dazu geführt, dass die Hamburger Schüler über dem bundesweiten Durchschnitt liegen.“ Doch Vorsicht: Die Interpretation ist nicht so scherenschnittartig, wie es die Behörde darstellt. Die 482 Punkte, die heute Platz 4 bedeuten, hätten 2018 nur für Rang 13 gereicht.
Die IQB-Daten zeigen nicht nur fachliche Defizite. Auch die Lernmotivation und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind seit 2018 weiter gesunken. Rund die Hälfte der Jugendlichen gibt an, in Mathematik, Chemie und Physik kaum Interesse zu haben. In Biologie sind es 43 Prozent. Gleichzeitig berichten 17 Prozent von häufigen emotionalen Problemen, 16 Prozent von starker Unaufmerksamkeit. Die Schulverbundenheit hat abgenommen, psychosoziale Auffälligkeiten haben zugenommen – besonders bei Mädchen.
Woher das kommt? Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass die Testungen 2018 noch vor der Corona-Pandemie lagen. Die nun getesteten Neuntklässler waren zu Beginn der Pandemie gerade Fünftklässler – eine besonders sensible Phase. Wochenlange Schulschließungen und Distanzunterricht fielen damit in die Zeit des Übergangs in die weiterführende Schule. Hinzu kommen aktuelle weltpolitische Krisen und die verstärkte Nutzung sozialer Medien, die laut Studie die sozio-emotionale Entwicklung belasten könnten.
Neben den allgemeinen Leistungseinbrüchen zeigen die Daten auch deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Jungen schneiden in Mathematik im Schnitt um zwölf Punkte besser ab als Mädchen, während Mädchen in Biologie einen Vorsprung von 21 Punkten haben. In Chemie und Physik sind die Unterschiede geringer. Auffällig: Jungen überschätzen ihre Fähigkeiten in MINT-Fächern häufiger, Mädchen trauen sich weniger zu – trotz guter Leistungen in Biologie.
Für Ksenija Bekeris ist das ein zentrales Thema. Die Senatorin, selbst Lehrerin, sieht Bildungsgerechtigkeit als ihr Kernanliegen. „Es geht nicht nur um Fächer, sondern um Bildungserfolg“, betont sie. „Wir müssen dafür sorgen, dass beide Geschlechter gleiche Perspektiven haben.“