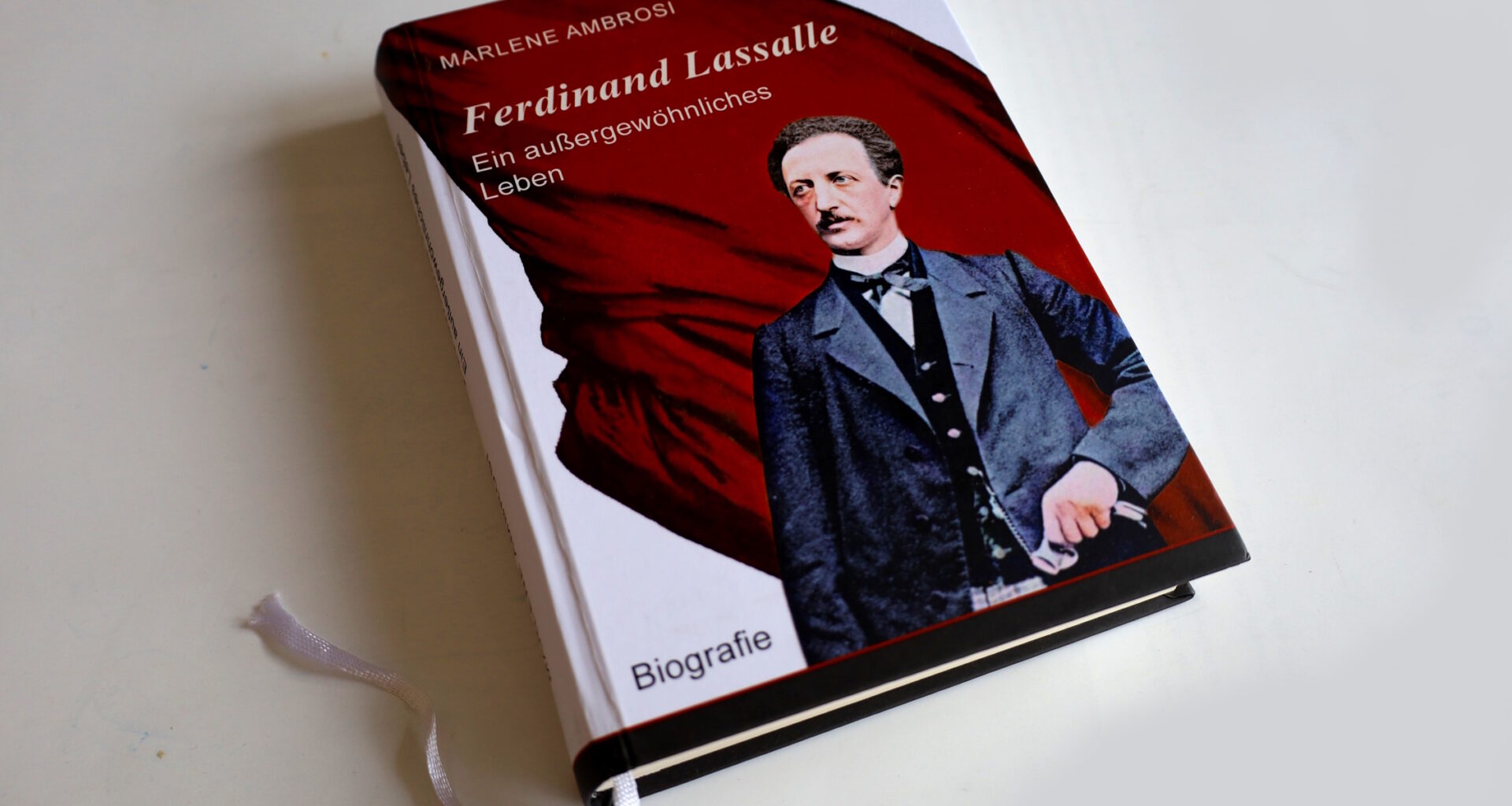Im April jährte sich der Geburtstag von Ferdinand Lassalle zum 200. Mal. Einige Medien berichteten zu diesem runden Geburtstag. Aber so richtig viel Feuerwerk gab es nicht. Obwohl Lassalle der erste Präsident der ersten Vorläuferpartei der SPD war, des Allgemeinen Deutsche Arbeitervereins (ADAV), der 1863 in Leipzig gegründet wurde, ein Jahr vor Lassalles Tod in einem Duell in Carouge bei Genf. Ein Tod, über den nicht nur Karl Marx und Friedrich Engels ihre Rauschebärte schüttelten.
Dabei ging es bei diesem Duell nicht einmal um verletzte Ehre oder Lasalles Rolle in der Arbeiterbewegung, sondern nur um den verletzten Stolz eines 39-jährigen, dem die Eltern seiner Wunschbraut diese Heirat verweigerten. Es ist nicht die erste Handlung des ungemein stolzen und selbstbewussten Ferdinand Johann Gottlieb Lassal aus Breslau, der sich selbst das französische e an den Namen hängte, weil ihm das eindrucksvoller erschien.
Was die Historikerin Marlene Ambrosi hier vorgelegt hat, ist geradezu eine Tiefenerkundung des rebellischen Kaufmannssohnes, dem ganz und gar nicht in die Wiege gelegt war, dass er einmal der erste und geradezu glorifizierte Führer der deutschen Arbeiterbewegung werden sollte. Nach seinem Tod gab es einen regelrechten Kult um ihn, den es in dieser Form später erst wieder um August Bebel geben würde.
Wie man in die Geschichte gerät
Es ist nicht das erste Werk, in dem sich Ambrosi intensiv mit einer bekannten Persönlichkeit der deutschen Arbeiterbewegung beschäftigt hat. Sie hat schon fundierte Bücher über Helene Demuth, „die treue Seele im Hause Marx“, über Friedrich Engels und über Jenny Marx, die Frau an der Seite von Karl Marx geschrieben. Also über ein ganzes Figurenensemble, das bei den Historikern eher nur am Rande vorkommt.
Ohne das aber die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und dessen, was man so Marxismus nennt, gar nicht denkbar ist. Geschichte wird von Persönlichkeiten gestaltet. Und oft landen sie mitten im Auge der Geschehnisse, ohne damit gerechnet zu haben.
So ging es auch Ferdinand Lassalle, der eigentlich in die Fußstapfen seines Vaters treten sollte und den Kaufmannsberuf erlernen sollte. Dazu wurde er auch kurzzeitig nach Leipzig geschickt, nachdem er schon in Breslau gegen den Schulalltag und autoritäre Lehrer rebelliert hatte. Und auch in Leipzig legte er sich mit den pädagogischen Autoritäten an. Was man aus der Sicht des Nachgeborenen nur zu gut versteht.
Der Knabe war hochbegabt und wahrscheinlich von den damaligen Schulen schon frühzeitig unterfordert. Was auch negative Folgen hatte. Denn da Marlene Ambrosi auch seine Tagebücher und seine Briefe rezipiert und ausführlich zitiert, begegnet man letztlich einem jungen Mann, der das Gefühl der Überlegenheit auch seine direkte Mitwelt immerfort spüren ließ.
Er konnte seine Mitmenschen gründlich brüskieren, andere Zeitgenossen faszinierte er, weil er sie intellektuell herausforderte. Auch Männer wie Alexander von Humboldt, Karl Marx, Heinrich Heine, aber selbst Otto von Bismarck, der ihn als frischgebackener preußischer Ministerpräsident mehrmals zu inoffiziellen Gesprächen einlud, weil er durch Lassalle einen Einblick in die Lage der Arbeiterschaft erhielt.
Fast ein Unding, wenn man den erzkonservativen späteren Reichskanzler hier mit dem furiosen Redner der sich gerade formierenden Arbeiterklasse bei trauten Gespräch sitzen sieht. Aber eben möglich. Trotz alledem, kann man sagen.
Nicht kleinzukriegen
Denn gleichzeitig gehörte Lassalle ja zu den wenigen, die sich in der Revolution von 1848/1849 betätigt haben, die nach der gescheiterten Revolution Deutschland nicht verließen, sondern den Kampf im Land weiterfechten wollten. Was ihm dann gleich mehrere Prozesse wegen Staatsgefährdung und entsprechende Verurteilungen zu Gefängnisstrafen einbrachte. Gegen die er immer wieder in Revision ging, obwohl er Jura gar nicht studiert hatte.
Aber selbst in seinen Verteidigungsreden muss er die Staatsanwälte und Richter zutiefst frustriert haben und konnte immer wieder auch eine deutliche Senkung des Strafmaßes erreichen, wohl wissend, dass alle Anklagen reine Willkür waren und ein obrigkeitlicher Versuch, den begnadeten Redner und Streitschriften-Schreiber kaltzustellen.
Aber wahrscheinlich brauchte man, um das so stolz und unnachgiebig durchzustehen, wirklich dieses gewaltige Ego, mit dem Lassalle in allen Lebenslagen seine Position vertrat. Auch den Eltern gegenüber, die oft genug Blut und Schweiß geschwitzt haben dürften über die Kapriolen ihres Sohnes, der ohne viel Federlesens auch die Schule abbrechen konnte, nur um dann Jahre später in einem Husarenritt gegen starrköpfige Prüfer dann doch die Studienberechtigung zu erwerben.
Aber statt etwas Praktisches zu studieren, mit dem er als Sohn aus einem jüdischen Elternhaus eine finanzielle Grundlage fürs Leben hätte erwerben können, stürzte er sich auf das brotloseste aller Studienfächer – die Philosophie. Nur um dann in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten zu beweisen, wie leicht ihm auch das fiel.
Während er fast gleichzeitig einen regelrecht juristischen Kampf für die Rechte der von ihrem Ehemann gedemütigen Gräfin Hatzfeld begann. Ein Kampf, der ihn über Jahre in Anspruch nehmen würde – samt einem Skandal um eine gestohlene Dokumenten-Kassette – und der letztlich mit einem Erfolg für die Gräfin und ihn ausging. Und der Lassalle gleichzeitig auch mediale Bekanntheit verschaffte. Ein Ruhm, den er zu nutzen verstand.
Ein Royalist als Arbeiterführer
Und so lernt man im Grunde einen Mann kennen, der wie kein Anderer begabt war, mitten im Rampenlicht seine Kämpfe auszutragen, sich selbst als Angeklagter nicht einschüchtern ließ und stattdessen die Richter mit Reden in die Enge trieb, in denen er die Berechtigung seines Tuns ausführlich begründete.
Und so wie er in seinem Auftreten gar nicht daran dachte, sich einschüchtern zu lassen, so pflegte er auch einen anspruchsvollen Lebensstil, den ihm auch die Beteiligung an den Geschäften seines Vaters und später der gewonnene Hatzfeld-Vergleich ermöglichten. Im Auftreten war er eher ein Mann, den man im gehobenen Bürgertum verortet hätte.
Aber gleichzeitig brachten ihn seine Beschäftigung mit Philosophie und Ökonomie und die Bekanntschaft mit Karl Marx dazu, die Zukunft Deutschlands nicht mehr in der zunehmend verbürgerlichten Fortschrittspartei zu sehen, sondern in einer neuen Partei, in der die Arbeiter die Hauptrolle spielen sollten. Nur dass auch der von ihm initiierte ADAV geradezu auf den Mann an der Spitze zugeschnitten war. Weshalb der ADAV geradeswegs in seine erste Krise schlitterte, als Lassalle im Duell zu Tode kam. Das sah Bismarck dann wohl schon richtig: Eigentlich war Lassalle im Herzen Royalist. Der König hätte dann freilich auch Lassalle heißen können.
Gerade weil Ambrosi so viele persönliche Dokumente auswertet, wird die ganze Zwiespältigkeit Ferdinand Lassalles deutlich. Einerseits eine schillernde Gestalt, die sich auch von den staatlichen Verfolgungen nach der Niederschlagung der Revolution nicht einschüchtern ließ und den Anklägern mit grandiosen Reden Paroli bot.
Andererseits ein Mann, der sich eigentlich so gar nicht in die Welt der Arbeiterschaft einordnen lässt, der aber die ökonomischen Fakten nur zu gut kannte und den Zuhörern bei all seinen ADAV-Auftritten eben deshalb auch erklären konnte, warum sie sich zusammenschließen und was sie fordern mussten.
Kein Was-wäre-wenn
Und so steht zumindest kurz auch die Frage im Raum, was aus der deutschen Sozialdemokratie geworden wäre, hätte sich Lassalle nicht in einem wirklich grandios dummen Duell über den Haufen schießen lassen? Wie hätte Lassalle die deutsche Arbeiterbewegung der nächsten Jahrzehnte geprägt?
Die Antwort wird wohl dieselbe sein, die es mit seinem Duell-Tod gegeben hat. Denn die in Dokumente überlieferten Krankheitssymptome, mit denen sich Lassalle schon Jahre vor seinem Tod herumschlug, deuten darauf hin, dass er auch so nicht viel älter geworden wäre. Auch das erzählt Ambrosi.
So dass am Ende kein Was-hätte-sein-Können steht, sondern das kurze, aber eindrucksvolle Leben eines Mannes, der seine Zeitgenossen beeindruckte, der sich selbst von Gefängnisstrafen nicht einschüchtern ließ und damit letztlich auch ein Standing zeigte, das man bei vielen heutigen Politikern vermisst. Auch wenn man sich die ganze Zeit fragt: Wie war es mit diesem so von sich überzeugten Mann überhaupt auszuhalten? Hätte er der deutschen Arbeiterbewegung tatsächlich gutgetan?
Oder wäre er mit seinem Ego letztlich doch gescheitert? Das wissen wir natürlich nicht. Auch wenn das Urteil, das Marx und Engels dann über den im Duall Gestorbenen fällten recht deutlich war. Sie kannten ihn ja persönlich, samt seinen rigorosen Einstellungen und dem oft genug fehlenden Mitgefühl.
In dem sie sich dann wohl auch selbst wiedererkannten. Anders prägt man am Ende wohl nicht derart die Geschichte. Männer eben, möchte man sagen. Aber das gehört halt auch zum Erbe der Sozialdemokratie. Bis in die Unlogik eines Duells hinein, an dessen Ende Lassalle schwer verwundet abtransportiert wurde.
Ein Bourgeois unter Arbeitern
Ob das Experiment ADAV gut ausgegangen wäre, wenn er überlebt hätte, darf man getrost mit Fragezeichen versehen. Denn, so Ambrosi: „Es gab Wegbegleiter, die sich von Lassalles Alleinherrschaft distanzierten und in Opposition gingen, weil sie eine derartige Machtfülle in der Hand eines Einzelnen nicht gutheißen konnten.
Manche störte auch, dass der Präsident der ersten deutschen Arbeiterpartei ein Fremdkörper unter den Arbeitern war, wie im Übrigen die meisten Vorsitzenden von Arbeiterparteien, bis heute. Ferdinand Lassalle war ein Bourgeois, führte ein mondänes Leben in ‚einer hübschen Salonatmosphäre‘, während die Lebensumstände der Klientel, die er vertrat, ihm zutiefst fremd waren.“
Das sind so die kleinen Hinweise einer Historikerin darauf, dass man auch in sozialdemokratischen Parteien vielleicht etwas aus der Geschichte lernen kann.
Aber Eindruck macht eben auch, dass Lassalle – anders als fast alle Revolutionsführer von 1848 – nicht ins Exil ging, obwohl er sehr genau wusste, dass verbitterte Staatsanwälte jede seiner Schriften gegen ihn verwenden würden. „Hatte er bisher die Hoffnung, die Justiz würde ihn nicht mehr belangen, erkannte er nun, dass jede seiner Reden, jede politische Broschüre justiziabel war“, schreibt Ambrosi zum Jahr 1864. „Er konnte sagen, was er wollte, er war staatliche Verfolgung, Untersuchungshaft und Gefängnisstrafen ausgesetzt.“
Er stand unter strengster Beobachtung. Und alles, wirklich alles konnte ihm als Staatsgefährdung ausgelegt werden. Andere wären allein daran schon zerbrochen. Doch gerade sein mutiger Widerstand verschaffte ihm auch Respekt und Anerkennung. Auch wenn er dann die sich tatsächlich formende Sozialdemokratie in Deutschland nicht mehr prägen konnte.
Und so ist Ambrosis reich mit Zitaten gespicktes Buch die Rekonstruktion einer Persönlichkeit, ohne die die frühe Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung nicht denkbar ist. Und die man kennen sollte, wenn man verstehen will, wie sich dieses Stück deutsche Geschichte entwickelte. Geschichte, die auf beiden Seiten von Persönlichkeiten gemacht wird, wenn auch nicht immer so blendenden wie Bismarck und Lassalle.
Marlene Ambrosi „Ferdinand Lassalle“ BoD, Hamburg 2025, 24 Euro.