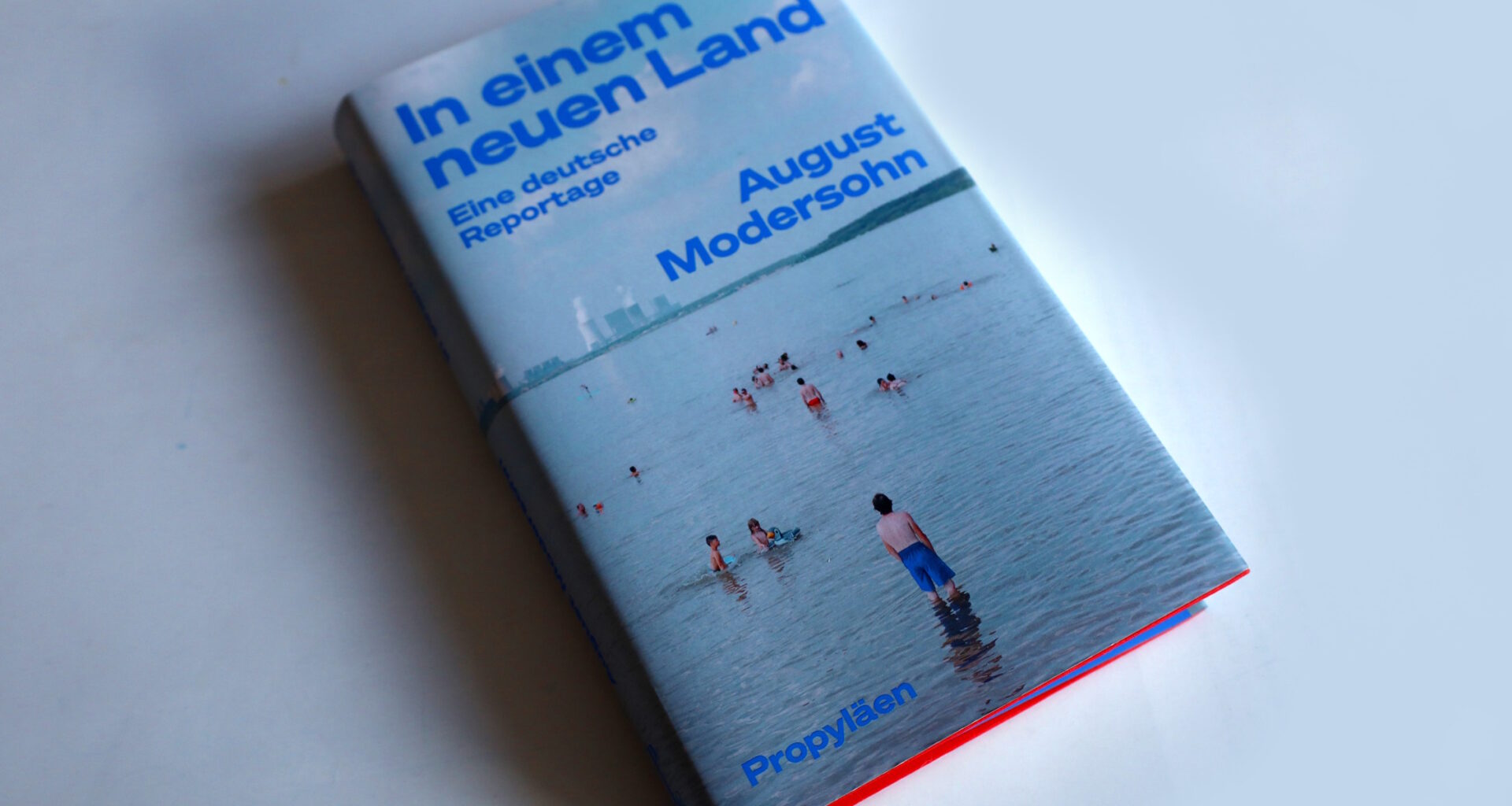Deutschland hat sich verändert seit der Wiedervereinigung im Oktober 1990. Aber wenn man den üblichen Diskussionen so zuhört, ist es nicht so zusammengewachsen, wie sich das Willy Brandt damals wohl gedacht haben mag. Gerade bei allen ökonomischen Parametern sind die alten Grenzen noch heute auf jeder Landkarte erkennbar. Und irgendwie scheint der Osten nun auch noch irgendwo ins rechte Nirwana abzudriften. Aber stimmt das so? August Modersohn wollte es wissen und ging auf Reisen.
Er hat das Glück, als Leiter des Leipziger Büros der Wochenzeitung „Die Zeit“ recht flexibel zu sein. Interessiert ihn ein Vorgang, ein Ereignis, ein Ort besonders, dann setzt er sich in den Zug und fährt hin, unterhält sich mit den Leuten, schreibt eine Reportage darüber. Und stellt dabei natürlich auch die Fragen zum Befinden der Menschen, zu ihrem Umgang mit den Veränderungen, die ihre Stadt und die Landschaft im Griff haben.
Aber auch zu ihrem Verständnis von Politik. Was dann die Frage nach der einen Partei immer wieder einschließt, die seit Jahren davon profitiert, dass die Transformation in einstigen deutschen Industriegebieten zu heftigen Einschnitten führte und einer anhaltenden Verunsicherung, zu Frust und Abschottung.
Logisch, dass Modersohn da auch nicht den Landkreis Sonneberg in Thüringen auslässt, wo seit zwei Jahren erstmals ein Landrat von der AfD agiert. Aber er fährt auch ins Brandenburger Kohlerevier, wo aus einstigen Kohlegruben eine regelrechte Seenlandschaft geworden ist, die Leute aber durchaus ihre Fragen haben, was aus der Region wird, wenn spätestens 2038 die Kohlebagger ihre Arbeit einstellen.
Es ist nicht das einzige Revier in Deutschland, das über Jahrzehnte von der Kohle lebte. Solche Reviere gibt es auch im Westen. Und auch dorthin ist Modersohn gefahren. Denn wer das „neue Land“ verstehen will, muss beide Seiten kennen.
Auch den alten Westen gibt es nicht mehr
Und er muss auch zulassen können, dass es den alten Westen, wie er vor 1990 als Bonner Republik seine Schönheitsträume träumte, nicht mehr gibt, dass die Einheit beide Landesteile verändert hat. Und möglicherweise die Parteien der alten Bonner Republik heftig überfordert hat. Auch das sollte man langsam thematisieren: Wenn ein ganzes Land sich verändert, müssen auch die Parteien sich verändern. Und lernen, für beide Landesteile zu denken, also für das Ganze, nicht immer nur für die westliche Hälfte, die man mit Märchen und Mythen verklärt, die nichts mehr mit der Gegenwart zu tun haben.
Auch dort kann man lernen, wie Transformation funktioniert. Im alten Ruhrpott zum Beispiel, wo der Bergbau schon viel früher abgewickelt wurde als in Ostdeutschland. Nur passierte das noch mit einer starken gewerkschaftlichen Begleitung und staatlicher Abfederung für die Kumpel. Es ging nicht so drastisch zu wie nach 1990 im Osten, wo praktisch über Nacht ganze Industriezweige und Industrieregionen abgeklemmt wurden und ein demografischer Aderlass ausgelöst wurde, von dem sich der Osten nicht mehr erholen wird.
Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum die Stimmung im Osten gekippt ist. Natürlich. Wer die Verluste direkt vor der Nase hat, der kann sie nicht mehr wegträumen. Und wenn dann auch noch die jungen, gut ausgebildeten Frauen verschwinden, dann bleiben nicht nur die Alten allein zurück, sondern auch die jungen Männer, die nun mit ihrer Ratlosigkeit nach irgendetwas wie Respekt suchen. Die AfD muss eigentlich nur alle Frustrierten einsammeln.
Skurrile Verhältnisse
Und das tut sie nicht nur im Osten, sondern auch in den abgehängten Revieren des Westens. Mit zuweilen skurrilen Erscheinungen wie in Berlin, wo der – längst demontierte – Mauerstreifen den Osten vom Westen trennt, nur dass im Osten der von reiche Zuzüglern bewohnte und top sanierte neue Kosmos Mitte liegt, westlich der arm gebliebene Wedding.
Der Kaffee ist im Osten also teurer als im Westen. Aber skurrile Verhältnisse findet Modersohn auch im wohlhabenden Freiburg, wo das abgehängte Viertel Weingarten wie ein Fremdkörper an der reichen Stadt hängt, in der das Lebensgefühl grün ist, während in Weingarten die Armen leben, die Abgehängten. Mit entsprechend abweichenden Wahlergebnissen. Ganz ähnlich wie in Pforzheim, das von den Wahlergebnissen her eigentlich auch Osten liegen könnte.
Denn längst ist der Rechtsrutsch, der medial scheinbar nur den Osten erfüllt, auch in den abgehängten Städten des Westens angekommen. Und da Modersohn immer wieder nachfragt, kommt er zumindest den Motiven ein Stück näher, die immer mehr Menschen zu Wählern der AfD werden lassen.
Natürlich hat es mit Frustration zu tun. Ein Grünen-Stadtrat in Freiburg hat da – wie Modersohn feststellt – durchaus interessante Antworten: „Viele Leute haben mit dieser Wahl eine Art Genugtuung verspürt. Sie haben gemerkt, dass sie damit dem Establishment Schaden zufügen können – unabhängig davon, dass sie mit ihrer Stimme sich selbst schaden.“
Womit ein Motiv deutlich wird, das in der etablierten deutschen Politik so gern negiert wird: Dass Menschen Ohnmacht nicht wirklich dauerhaft aushalten. Das Gefühl, abgehängt und kaltgestellt zu sein. Menschen brauchen das Gefühl von Wirksamkeit. Nur kann das eben völlig irrationale Züge annehmen. Aber auch überraschende, so wie in Sonneberg, wo der unerwartete Wahlerfolg des AfD-Mannes in der Landratswahl Parteien und Initiativen zusammengebracht hat, die vorher nicht mal miteinander geredet hätten.
Die fatalen Folgen von „Alternativlosigkeit“
Denn der fruchtbare Boden für die AfD wurde schon vorher bereitet. In Zeiten, in denen kurzsichtige Politikerinnen von „Alternativlosigkeit“ schwatzten, während sie dringende Reformen schlichtweg verweigerten und aussaßen. Dass in Deutschland überall ein riesiger Reformstau herrscht, der ganze Regionen regelrecht in Lethargie versetzt, das kriegen die Menschen ja mit.
Nicht nur die in der Lausitz, sondern auch die in Halle, wo Modersohn den nun ehemaligen Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby besucht, in Duisburg, wo die Deindustrialisierung ihre eigenen Formen angenommen hat, selbst in Grafenwöhr, wo der Bürgermeister sich vor dem Tag fürchtet, an dem die Amerikaner tatsächlich abziehen.
Während im Bayerischen Wald ein kleines Westerndorf die Vision eines verklärten Amerika am Leben erhält und in Görlitz die Gemüter kochen, weil aus einem Schienenfahrzeugwerk eine Panzerfabrik werden soll. Während die Stadt sich längst in eine bloße Filmkulisse verwandelt hat, die zusehends vergreist.
Und so gibt es die Verlierer der überall greifbaren Transformation, die wütend ihre Stimme als Denkzettel bei Wahlen abgeben. Vielleicht sogar hoffend, dass das Wahlergebnis die etablierten Parteien aus ihrer Lethargie reißt.
Und es gibt, in der Lausitz genauso wie in Dresden oder Duisburg, die Unermüdlichen, die in den Veränderungen auch Chancen sehen, das Land oder wenigstens den Ort, an dem sie leben, zukunftsfähig zu machen, Ideen umzusetzen und vielleicht sogar Leute zu begeistern, dabei mitzumachen. Die sich aber auch zu dem Gefühl äußern, das die große Politik mittlerweile verbreitet. So wie es eine Frau aus Welzow in Südbrandenburg auf den Punkt bringt: „Uns ist die Weisheit abhandengekommen.“
Stimmt. Dazu genügt ein Blick auf die derzeitigen „Spitzen“ der Politik.
Männer in Nöten
Und bei einem Männerprojekt in Dresden stolpert Modersohn natürlich über ein Problem, das mit dieser Verknöcherung zu tun hat: Männer, die sich in all diesen Veränderungen nicht mehr wiederfinden können, erwecken uralte patriarchalische Selbstbilder wieder zum Leben, glauben in Selbstinszenierungen von Kraftmeierei und Frauenfeindlichkeit wieder so etwas wie eine Bestätigung ihrer Männlichkeit zu finden.
Ihre psychologischen Probleme verwandeln sie in rabiaten Antifeminismus. Als wenn ausgerechnet die Frauen an ihrem Dilemma schuld wären. Sie flüchten regelrecht in die „Mannosphäre“, weil ihnen die erlebte Gegenwart keine sinnvollen Angebote macht.
Auch das gehört zu den Erkenntnissen dieser Reisen durchs Land: Dass es gerade die alten Selbstverständlichkeiten männlicher Definition über Arbeit und Karriere sind, die gerade in den deindustrialisierten Regionen ins Rutschen gekommen sind. Und offene Fragen stehen lassen.
Wer holt diese Menschen in ihrem Frust ab? Wer macht tatsächlich umsetzbare Lösungsvorschläge? Unter den Politikern, die Modersohn gefragt hat, ist auch der Linkspolitiker Jan van Aken, der sich sicher ist, dass nur die Linkspartei diese Rolle übernehmen kann. Und er begründet das auch, weil es auch darum geht, Milieus wieder in Verbindung zu bringen, die heute schroff nebeneinander stehen – nicht nur in Freiburg oder Berlin, sondern überall im Land, eine Koalition der „linksgrünen Hipster aus den Innenstädten, der Arbeitsmigrantinnen und der prekarisierten Ostdeutschen“.
Modersohns trockener Kommentar: „Das wäre auf jeden Fall noch eine kühne Volte der Geschichte.“
Ein deutscher Flickenteppich
Oder es wäre die simple Anerkennung dessen, dass sich ganz Deutschland mitten im Umbruch befindet. Und die Lösung nur darin bestehen kann, wieder gemeinsame Visionen für das ganze Land zu entwickeln. Und nicht das Geklecker in alten Alternativlosigkeiten, das so gern als Realpolitik verkauft wird.
So richtig ist das gemeinsame neue Deutschland noch nicht da. Und das, das wir haben, leidet unter Unvereinbarkeiten, die auch schlicht damit zu tun haben, dass ein guter Teil des politischen Establishments immer noch von den schönen Zuständen der 1950er Jaher in Bonn träumt und die Rwalität des Jahres 2025 schlicht ignoriert. Von der Frustration ganzer Bevölkerungsschichten ganz zu schweigen.
So gesehen ist Modersohns Reisebuch eine Bestandsaufnahme eines Flickenteppichs, der von der Lückenhaftigkeit deutscher Politik erzählt. Und von der Wirkungslosigkeit abgestandener Rezepte für ein Land, das sich seit 1990 längst so sehr verändert hat, dass man ihm mit den Reförmchen des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr beikommt. Sondern eine andere, weisere Politik notwendig wäre, die Menschengruppen nicht ausgrenzt und abwertet, sondern einbindet.
Aber da merkt man schon bei der Formulierung, dass man dazu Politikerinnen und Politiker von anderem Format bräuchte.
August Modersohn „In einem neuen Land“ Ullstein Propyläen, Berlin 2025, 24 Euro.
Veranstaltungstipp: Am 20. November liest August Modersohn im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig
Wie hat sich Deutschland seit dem 3. Oktober 1990 verändert? Was hat sich in Duisburg getan, seit Helmut Kohl den großen Aufbruch angekündigt hat, und was in der Lausitz? Der Reporter August Modersohn reist von West nach Ost, von Süd nach Nord. Er vergleicht, was vor 35 Jahren begonnen hat, mit dem, was entstanden ist.
Sein Eindruck: Vielfach wird übersehen, wie stark sich nicht nur der Osten, sondern das ganze Land in einer Generation verändert hat. Die alte Bundesrepublik ist Geschichte – Erinnerungen an sie klingen in Modersohns Ohren oft wie Märchen aus uralten Zeiten. Wie viel ist im Westen alt beziehungsweise alt geblieben? Aber auch: Was vom Alten ist im Osten abgeschafft worden und fehlt jetzt?
 August Modersohn. Foto: Thomas Victor
August Modersohn. Foto: Thomas Victor
August Modersohn besuchte Gegenden, die sich besonders verändert haben, und solche, die völlig unberührt (und ungerührt) von der Transformation blieben. Als Reporter ohne vorgefasstes Bild erkundete er dieses neue Land, immer auf Überraschungen gefasst. Im Gespräch mit Anne Hähnig geht er nun den Fragen nach, die ihn zu seiner Reise durchs Land angetrieben haben und spricht über die Veränderungen der letzten Jahrzehnte beziehungsweise die Auswirkungen, die bis heute bleiben.
August Modersohn wurde 1994 im Westen Berlins geboren, kam in Dresden zum Journalismus und in Leipzig zur Wochenzeitung Die Zeit. Das Medium Magazin wählte ihn 2020 unter die „Top 30 bis 30“ und 2024 unter die „Politik-Journalisten des Jahres“. Seit 2022 ist er stellvertretender Leiter des Leipziger Zeit-Büros und berichtet von dort über Ostdeutschland.
Anne Hähnig ist Redaktionsleiterin von Zeit.de. Zuvor leitete sie das Ressort „Zeit im Osten“ beziehungsweise das Leipziger Korrespondentenbüro der Zeit. Sie wurde 1988 im sächsischen Freiberg geboren, hat die Deutsche Journalistenschule in München besucht und Politikwissenschaft an der Uni Leipzig studiert. Im Jahr 2024 wurde sie vom Medium Magazin als Politikjournalistin des Jahres ausgezeichnet.
Buchvorstellung und Gespräch am Donnerstag, dem 20. November, 19:00 Uhr im Saal des Zeitgeschichtlichen Forums (Grimmaische Straße 6): „In einem neuen Land – Eine deutsche Reportage“ mit August Modersohn (Autor) und Anne Hähnig (Journalistin). Eintritt frei.