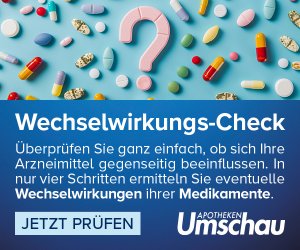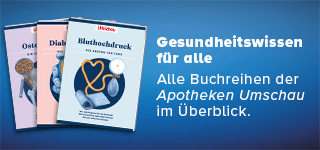In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten, passive und indirekte Sterbehilfe jedoch erlaubt, wenn sie dem Patientenwillen entsprechen. Der assistierte Suizid bleibt rechtlich umstritten, er liegt in einem Graubereich. Ein Überblick.
Wie ist die Rechtslage bei der Sterbehilfe in Deutschland?
Ist Sterbehilfe in Deutschland erlaubt oder verboten? Dazu muss man zunächst zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe unterscheiden.
Aktive Sterbehilfe bedeutet, dass man einem Patienten oder einer Patientin aktiv etwas gibt oder etwas tut, so dass diese oder dieser stirbt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Arzt einer Patientin auf ihren Wunsch hin eine Spritze mit einer Überdosis eines Medikaments gibt mit dem Ziel, dass sie daran verstirbt. Aktive Sterbehilfe ist bisher in Deutschland verboten und steht unter Strafe. Sie wird mit einer Haftstrafe bestraft, die einige Jahre umfassen kann.
Passive Sterbehilfe ist das bewusste Unterlassen oder Beenden lebenserhaltender Maßnahmen. Es wird häufig auch als Sterbenlassen bezeichnet. „Wenn auf einer Intensivstation ein Beatmungsgerät abgestellt wird, dann ist das passive Sterbehilfe. Diese ist hierzulande erlaubt, wenn die lebenserhaltenden Maßnahmen nicht mehr medizinisch geboten sind oder nicht dem Willen des Patienten oder der Patientin entsprechen“, sagt Anja Lehmann, juristische Beraterin bei der Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD).
Die Entscheidung dazu kann etwa auf einer bestehenden Patientenverfügung fußen, oder sie wird gemeinsam mit engen Angehörigen getroffen, so dass der mutmaßliche Wille des Patienten oder der Patientin umgesetzt wird.
Außerdem gibt es eine indirekte Sterbehilfe, die in der Palliativversorgung, also in der Versorgung todkranker Menschen, zum Tragen kommt. Bei der indirekten Sterbehilfe befindet sich ein Mensch bereits im Sterbeprozess. Wenn er etwa schmerzlindernde Medikamente in einer Dosis benötigt, die auch dazu führen kann, dass der Patient früher verstirbt, dann können diese im Rahmen von indirekter Sterbehilfe gemäß der gültigen Rechtslage in Deutschland gegeben werden.
„Die indirekte Sterbehilfe bezieht sich auf Maßnahmen, die Schmerz und Leiden mindern und als unbeabsichtigte Nebenwirkung den Tod des Patienten oder der Patientin beschleunigen können. Auch das ist in Deutschland erlaubt“, sagt Lehmann. Wichtig sei aber, dass die Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Patientenwillen geschehen, tatsächlich medizinisch geboten sind und zur Linderung des Leidens beitragen. Sobald man die Maßnahmen mit dem Ziel durchführe, nicht das Leiden zu lindern, sondern das Leben zu beenden, ist es aktive Sterbehilfe, die verboten ist.

Was regelt eine Patientenverfügung?
Wenn ein Patient oder eine Patientin im Krankenhaus künstlich ernährt und beatmet werden muss und die behandelnden Mediziner keine Informationen haben, was der Wille des Patienten oder der Patientin ist, werden die lebenserhaltenden Maßnahmen meist sehr lange fortgeführt. Das kann in manchen Fällen im Sinne des Patienten oder der Patientin sein, in anderen Fällen aber auch dem Willen widersprechen. In einer Patientenverfügung kann man festlegen, ob und wann man passive Sterbehilfe erhalten möchte, und unter welchen Umständen man sie nicht haben möchte.
„Am besten ist es, wenn man eine Patientenverfügung hat, die von einem selbst und auch von seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin oder einem beratenden Mediziner unterschrieben ist. Dann wissen Mediziner und Angehörige, welche lebensverlängernden Maßnahmen man befürwortet und welche man ablehnt“, sagt Elisabeth Frischhut vom Deutschen Caritasverband. Sie empfiehlt daher jeder und jedem Menschen, einmal – am besten in gesunden Zeiten – eine solche Patientenverfügung zu verfassen. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Hausarzt oder der Hausärztin beraten,
„Außerdem sollte man all diese Dinge, die in der Patientenverfügung stehen, auch noch mit einem Menschen besprechen, dem man vertraut und den man dann in seine Vorsorgevollmacht einträgt. Dann kann dieser Mensch des Vertrauens in dem Fall, dass man es selbst nicht mehr kann, dafür sorgen, dass diese Wünsche in der Patientenverfügung auch umgesetzt werden“, sagt Frischhut.

Was ist assistierter Suizid?
Der assistierte Suizid wird auch Beihilfe zur Selbsttötung genannt. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Selbstmord, ausgeführt vom Patienten oder der Patientin. Der Arzt oder die Ärztin darf eine Hilfestellung leisten, aber die Ausführung – das ist wichtig und entscheidend – muss allein beim Patienten oder der Patientin liegen. Eine Ärztin darf einem Patienten theoretisch zum Beispiel Pillen mitgeben, die nach der Einnahme dafür sorgen, dass der Patient verstirbt. Der Patient nimmt die Pillen mit nach Hause, nimmt sie ein und verstirbt – ein assistierter Suizid. Dies ist in Deutschland – theoretisch – erlaubt.
Theoretisch, weil es hier eine Grauzone gibt. „Sie beginnt schon bei der Verschreibung oder Herausgabe der Mittel durch die Mediziner. Denn im Betäubungsmittelgesetz heißt es: Ärzte dürfen Betäubungsmittel nur verschreiben oder überlassen, wenn ihre Anwendung am oder im menschlichen Körper begründet ist. Bisher versteht man darunter, dass sie nur zur Heilung verwendet werden dürfen, aber eben nicht für einen Suizid“, sagt Anja Lehmann von der UPD. Auch wegen solcher Unsicherheiten komme für die meisten Ärztinnen und Ärzte der assistierte Suizid nicht infrage.

Was ist Angehörigen, Medizinern und Außenstehenden erlaubt – und was nicht?
Anhand der oben genannten Arten von Sterbehilfe und ihren rechtlichen Regelungen wird deutlich: Angehörige, Mediziner und andere Außenstehende dürfen nach geltender Rechtslage in Deutschland niemals aktiv für das Sterben einer Patientin oder eines Patienten sorgen. Sie dürfen aber sehr wohl, wenn es der Patient oder die Patientin wünscht, bei den Vorbereitungen eines Suizids helfen. Die Handlung des Suizids muss die Patientin oder der Patient allerdings vollständig selbst machen.
Sterbehilfe-Vereine, die eine geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung anbieten, waren in Deutschland verboten – dann, Anfang 2020, kippte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) das Verbot. In dem Grundsatzurteil betonte das BVerfG, dass jeder ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben habe – und dieses Recht umfasse auch die Freiheit, sich dafür Hilfe von Dritten zu holen.

Über welche gesetzlichen Änderungen wird derzeit diskutiert und wo liegen die Risiken?
Seit dem Grundsatzurteil des BVerfG im Jahr 2020, das dazu führte, dass Sterbehilfe-Vereine einen assistierten Suizid in Deutschland anbieten dürfen, wird darüber diskutiert, welche Regeln genau für ein solches Angebot gelten sollen. Im Sommer 2023 wurde über zwei Gesetzesentwürfe im Bundestag abgestimmt. Beide Gesetzesentwürfe überzeugten die Mehrheit der Abgeordneten noch nicht, sie wurden abgelehnt.
In einem Gesetzesentwurf wurde unter anderem vorgeschlagen, dass Sterbewillige sich mindestens zweimal in einem Mindestabstand von drei Monaten einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Begutachtung unterziehen sollten. In einem anderen, etwas liberaleren Entwurf, wurde vorgeschlagen, dass Mediziner bereits drei Wochen nach einer Beratung ein tödliches Mittel verschreiben dürfen.

Solche Regeln zur Beratung und den zeitlichen Abständen zwischen Beratung und tatsächlicher Durchführung des Suizids sollen vor einem Missbrauch der Sterbehilfe schützen. Denn wenn die Möglichkeiten der Sterbehilfe eindeutig geregelt und damit unkompliziert vorhanden sind, besteht immer auch das Risiko, dass ein gewisser sozialer Druck entsteht: Im schlimmsten Fall nehmen schwerkranke Menschen dann Sterbehilfe in Anspruch, nur um den Angehörigen und der Gesellschaft nicht zur Last zu fallen.
Hinzu kommt: Selbst wenn ein Mensch eine Entscheidung zum Sterben getroffen hat, so bedeutet das keineswegs, dass diese Entscheidung dauerhaft ist. Häufig treffen die Menschen eine solche Entscheidung in einer Phase der tiefsten Verzweiflung, etwa weil sie große Schmerzen haben oder großen Kummer wegen dem Tod des Lebenspartners. „Das Ziel sollte daher nicht sein, die Möglichkeiten des Sterbens noch auszuweiten. Ziel sollte sein, den Menschen mehr Perspektiven und Unterstützung zu geben, damit das Leben wieder lebenswert wird“, sagt Frischhut.
Heißt etwa: Mehr menschliche und psychologische Betreuung für Trauernde, bessere Möglichkeiten zur Schmerzbehandlung. Denn laut Deutscher Gesellschaft für Schmerzmedizin bekommt nur einer von zehn Menschen mit chronischen Schmerzen die Behandlung, die er eigentlich braucht.
Auch die Suizidprävention sollte verbessert werden, sagt Frischhut: „Laut einer Münchner Studie wurde die Hälfte der assistierten Suizide bereits innerhalb einer Woche nach der Beratung vollzogen. Das ist ein viel zu kurzer Zeitraum – hier ist das Risiko zu hoch, dass ein Suizid in einem mentalen und körperlichen Tief vollzogen wird, obwohl man sich einige Tage später vielleicht gegen einen Suizid entscheiden würde. Nur ist ein Suizid eben nicht umkehrbar, das ist das tragische daran“, so Frischhut.
Sterbehilfe: Wie ist die rechtliche Situation in anderen Ländern?
In manchen anderen Ländern wie Belgien, den Niederlanden oder der Schweiz ist die Suizidhilfe etwas eindeutiger geregelt. „Aber wenn man es genauer betrachtet, dann gibt es in vielen Fällen – gerade im Vergleich zu Deutschland – auch wichtige Einschränkungen. In der Schweiz zum Beispiel ist der assistierte Suizid nur erlaubt, wenn man schwer krank ist. In Deutschland gibt es diese Einschränkung nicht: Theoretisch darf hierzulande jeder einen assistierten Suizid begehen. Hier sollte der Gesetzgeber bessere Regelungen schaffen“, sagt Elisabeth Frischhut vom Deutschen Caritasverband. Über genau solche Regelungen dürfte in absehbarer Zeit wieder als neue Vorschläge im Bundestag abgestimmt werden.
Hilfe bei Suizidgedanken
Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie bitte sofort die Telefonseelsorge. Die ist an anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800-1110111, 0800-1110222 und 116 123. Die Telefonseelsorge ist auch per E-Mail und Chat erreichbar. Weitere Infos finden Sie hier.