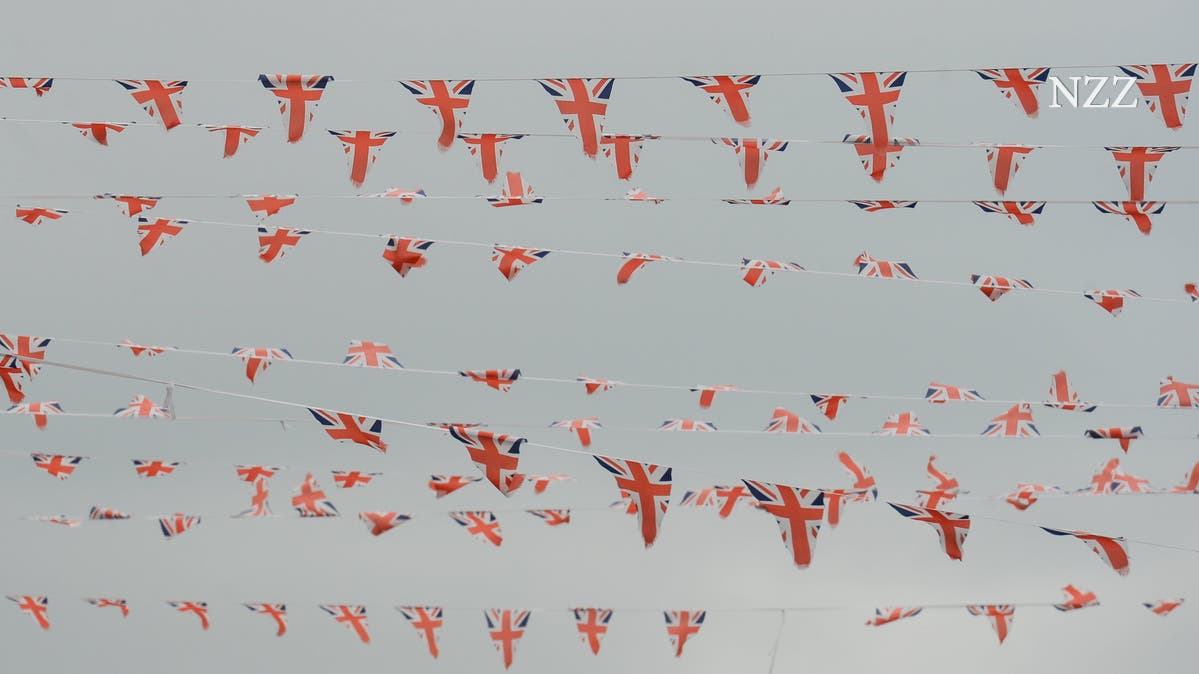Grossbritannien bereitet sich auf die Machtübernahme durch die rechtsnationale Partei Reform UK unter einem künftigen Premierminister Nigel Farage vor. Labour und Tories fürchten die Vernichtung. Dass es so weit kommen konnte, ist ihre eigene Schuld.
 In Grossbritannien sind die alten Eliten und ihre Ideen verbraucht. Sie haben das Vertrauen der Bürger verspielt und bringen das Land nicht mehr voran.
In Grossbritannien sind die alten Eliten und ihre Ideen verbraucht. Sie haben das Vertrauen der Bürger verspielt und bringen das Land nicht mehr voran.
Artur Widak / Imago
Am Mittwoch wird die britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves das Budget vorlegen. Sie wird viel von den Fehlern der konservativen Vorgängerregierung, den wirtschaftlichen Härten und den hohen moralischen Werten der Labour-Regierung sprechen. Und sie wird den Umstand kleinreden, dass auch diese Regierung ihre Wahlversprechen verletzen und den Bürgern höhere Lasten zumuten wird. Damit wird sie die Enttäuschung der Wähler über die politische Führung des Landes weiter verstärken.
Optimieren Sie Ihre Browsereinstellungen
NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.
Bitte passen Sie die Einstellungen an.
Die Briten haben schon so vieles versucht. Den lähmenden Strukturkonservativismus linker wie rechter Regierungen zerschlug in den achtziger Jahren die eiserne Lady Margaret Thatcher. Sie erneuerte das Land und die Wirtschaft und spaltete die Gesellschaft.
1997 folgten die Wähler in Scharen dem linksliberalen Hoffnungsträger Tony Blair. Dieser profitierte vom wirtschaftlichen Rückenwind von Thatchers Reformen und lancierte eine bahnbrechende Modernisierung des Sozialstaats. Seine Visionen zerbrachen dann allerdings 2008 im Scherbenhaufen der Finanzkrise und haben sich davon nie erholt.
Nach der traumatischen Finanzkrise war es Zeit für einen Wechsel, doch die Wähler trauten der alten Garde der Tories nicht ganz über den Weg. So gaben sie 2010 dem sozialliberal auftretenden Parteiführer David Cameron den netten Liberaldemokraten Nick Clegg an die Seite. Die ungewohnte Regierungskoalition verwaltete die trostlose Sparpolitik des konservativen Schatzkanzlers George Osborne redlich, vermochte aber niemanden zu begeistern.
Kein Heil durch den Brexit
Cameron suchte seine konservativen Kritiker 2015 mit der überraschenden Ankündigung einer Volksabstimmung über den Austritt aus der EU zu besänftigen, den er gleichzeitig ablehnte. Doch Cameron verlor sein riskantes Machtspiel, die Wähler stimmten Ja und versetzten die mehrheitlich gegen den Brexit angetretene politische Elite des Landes in einen Schockzustand, der bis heute nachwirkt.
Dieser Schock spülte 2019 den fröhlichen konservativen Populisten Boris Johnson an die Macht. Dieser setzte mit grossem Wählerzuspruch den Brexit durch, verlor sich aber bald in selbstverliebten Possen und Nachlässigkeiten. Politik sei kein Spiel, beschlossen die Wähler schliesslich und suchten ihr Heil 2022 in der nüchternen Sachkompetenz des früheren Finanzministers Rishi Sunak, bis sie nach vierzehn Jahren definitiv genug hatten von Tory-Regierungen.
Im letzten Jahr wählten sie mangels Alternativen Labour an die Macht. So erhielt das Land den visionslosen und knochentrockenen Juristen Keir Starmer zum Premierminister. Doch auch damit sind die Wähler nicht zufrieden, und Labour steckt bereits ebenso wie die Tories in einem existenzbedrohenden Umfragetief.
Ungelöste Probleme
Thatchers Härte, Blairs Charme, Camerons Beliebigkeit, Johnsons Frohsinn, Starmers Sprödheit – Grossbritannien hat in den letzten fünf Jahrzehnten unterschiedlichste Führungspersonen und Führungsstile ausprobiert. Am Ende bleibt nichts als Ratlosigkeit. Das Land empfindet eine tiefe Misere, aus der es anscheinend niemand herausführen kann.
Dieses weit verbreitete Gefühl gründet auf vier Problemfeldern:
Explodierende Staatsschulden: Trotz permanentem Spardruck, der für die Bürger durchaus negativ zu spüren ist, steigen die britischen Staatsausgaben strukturell an. Die Staatsschulden liegen mittlerweile knapp unter 100 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Deshalb maximiert jeder Schatzkanzler der jüngeren Vergangenheit die Aufnahme neuer Schulden bis hart an die Grenze dessen, was die Finanzmärkte gerade noch zulassen.
Ein Hauptgrund dafür ist das schwache Produktivitätswachstum der britischen Wirtschaft. Dieses müsste eigentlich durch Reformen gestärkt werden, doch während der Regierungszeit der Konservativen war wenig vom Reformeifer ihrer verstorbenen Führerin Margaret Thatcher zu erkennen. Sie haben nicht einmal die Chance des Brexits gepackt, der eigentlich einen Schub von Deregulierungen hätte ermöglichen sollen.
Ein zweiter Grund für die prekären Staatsfinanzen ist ein Sozialstaat, der immer mehr Bürger alimentiert. Premierminister Blair war in den neunziger Jahren ein Pionier für das Ziel, Arbeit wieder lohnend zu machen. Die ab 2003 eingeführten Hartz-Reformen der Regierung Schröder in Deutschland wurden etwa dadurch inspiriert. Auch die 2010 auf Labour folgende konservative Regierung mühte sich mit weiteren Sozialreformen ab.
Trotzdem ist die Zahl der Personen im Erwerbsalter, die Sozialleistungen wegen Arbeitsunfähigkeit oder Krankheit beziehen, in den letzten zehn Jahren von knapp 4 Millionen auf 6,5 Millionen gestiegen. Das sind rund 12 Prozent der Erwerbsbevölkerung. Fast 1 Million junge Briten unter 25 Jahren sind heute weder in Arbeit noch in Ausbildung (Neet). Zu ihrer Schwierigkeit, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, hat Labour im ersten Regierungsjahr durch eine Erhöhung der Sozialabgaben und des Mindestlohnes noch beigetragen. Belastend für die Staatsfinanzen ist auch die wachsende Wählergruppe der 13 Millionen Rentner, die Jahr für Jahr sehr grosszügige Rentenerhöhungen («triple lock») erhalten, an deren Kürzung sich niemand heranwagt.
Alle Regierungen der letzten fünfzehn Jahre haben lieber Arbeitnehmer aus dem Ausland importiert, als die Arbeitsanreize für die Erwerbsbevölkerung zu verbessern. Jetzt müsste Labour dringend die Sozialhilfe reformieren und das Wachstum der Altersrenten begrenzen. Beides könnte die chronischen Finanzprobleme des Staates lindern.
Grosse regionale Unterschiede: In keinem Wahlprogramm darf das Versprechen fehlen, den strukturell schwächeren Regionen, vor allem im Norden Englands, mit Investitionen und Initiativen auf die Sprünge zu helfen. Ebenso regelmässig resultiert daraus wenig Greifbares. So lancierte etwa die konservative Regierung Cameron 2010 den sehr teuren Bau von Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken von London nach Nordengland, angeblich um diese Regionen zu stärken. Fünfzehn Jahre später blieb von diesen Plänen bloss eine Highspeed-Strecke nach Birmingham übrig, die noch nicht einmal fertig gebaut ist. 2019 lockte Premierminister Boris Johnson traditionelle Labour-Wähler in Nordengland zu den Tories mit dem Versprechen des «levelling up», eines raschen Angleichens der Lebensverhältnisse. Auch daraus wurde nichts.
Die britische Wirtschaft, einst die Wiege der Industrialisierung, ist seit den siebziger Jahren stark deindustrialisiert worden. An die Stelle der Industrie trat ein innovativer, weltweit erfolgreicher Dienstleistungssektor. Dieser konzentriert sich allerdings primär in London, während ganze Landstriche in der Peripherie wirtschaftlich abgehängt sind. Die Schulen sind schlechter, die Erwerbschancen geringer. In einzelnen Wahlkreisen bezieht mehr als die Hälfte der Bewohner im erwerbsfähigen Alter Sozialhilfe. Die Bevölkerung ist frustriert und entfremdet sich von den als arrogant wahrgenommenen Politikern im fernen London.
Die Konservativen haben ihre Versprechungen in den Randregionen nie eingelöst. Will sich Labour an der Macht halten, muss die Partei für ihre ehemaligen Stammwähler in diesen Regionen kämpfen und ihnen endlich reale Aufstiegsperspektiven bieten. Ausser wohlfeiler Rhetorik deutet bis jetzt wenig darauf hin.
Ungezügelte Einwanderung: Unter New Labour war Multikulturalität Teil des gefeierten Images von «Cool Britannia». Zur traditionell starken Einwanderung aus dem ehemaligen Empire kamen offene Türen für Arbeitsmigranten aus den neu zur EU gestossenen ostmitteleuropäischen Staaten. Die Folge war ein Einwanderungsboom. Als dreizehn Jahre später die Konservativen an die Macht kamen, versprach Premierminister Cameron die Rückführung der Nettozuwanderung auf wenige Zehntausend pro Jahr. Stattdessen explodierte die Nettoeinwanderung Jahr für Jahr auf 200 000 bis 300 000 Personen und erreichte jüngst gar Rekordwerte von schier unglaublichen 900 000 Personen pro Jahr. Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs ist in den letzten fünfzehn Jahren um nicht weniger als 7 Millionen auf 69 Millionen gewachsen.
Die Politik der offenen Grenzen ist weniger ideologisch als wirtschaftlich begründet. Die chronische Wachstumsschwäche der britischen Wirtschaft müsste unter anderem durch Deregulierung sowie Investitionen in Schul- und Berufsbildung und Infrastruktur bekämpft werden. Doch viel einfacher lässt sie sich kurzfristig durch die Einwanderung von Arbeitskräften kaschieren, welche zum Wachstum des Bruttoinlandprodukts und der Staatseinnahmen beitragen.
Gleichzeitig profitieren einflussreiche Wählergruppen von der Einwanderung, allen voran die Besitzer von Wohneigentum, dessen Wert dank der wachsenden Nachfrage stark gestiegen ist. Aber auch viele Unternehmen und breite Mittelschichten können kostengünstige Dienstleistungen von Einwanderern nutzen, vom Verkäufer in der High Street bis zum Fensterputzer oder zur Nanny.
Die Kehrseite sind ein nur mässig wachsendes Einkommen pro Kopf der Bevölkerung, ein starkes Wachstum von Branchen mit niedriger Produktivität, eine verschärfte Wohnungsnot und die Überforderung des Gesundheitsdienstes (obschon dieser nur dank zahllosen ausländischen Arbeitskräften überhaupt noch irgendwie funktioniert).
In den letzten Jahren kam zur legalen Einwanderung noch die illegale Migration über den Ärmelkanal hinzu. In den zwölf Monaten bis Juni 2025 kamen auf diese Weise 43 000 Personen an. Diese machen zwar nur einen kleinen Teil der Zuwanderung aus, sorgen aber für Empörung. Die letzten Tory-Regierungen vermochten sie nie zu kontrollieren.
Nun hat Innenministerin Shabana Mahmood harte Massnahmen angekündigt. Diese sind laut Mahmood von den Asylreformen der dänischen Sozialdemokraten inspiriert, fallen aber weit dahinter zurück. Zudem ist offen, ob die nötigen Gesetzesänderungen die Zustimmung im Parlament und der Gerichte erhalten werden. Dabei müsste die Labour-Regierung dringend die Massnahmen Dänemarks kopieren und vor allem auch die legale Einwanderung drastisch reduzieren, um unzufriedene Stammwähler zurückzugewinnen. Doch wenig deutet darauf hin.
Unzureichendes Gesundheitssystem: Während der furiosen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London 2012 wurden in einer Szene plötzlich Krankenhausbetten von als Pflegerinnen kostümierten Tänzerinnen in das Stadion geführt. Was das internationale Fernsehpublikum wohl kaum verstand, war jedem Briten klar. Der Nationale Gesundheitsdienst (NHS), der allen Bürgern kostenlos zur Verfügung steht, ist ein zentraler Bestandteil der nationalen Identität. Die Gründung des staatlichen Dienstes in der Nachkriegszeit wird als wichtige Errungenschaft im Zeichen von Fortschritt und gesellschaftlichem Zusammenhalt gefeiert.
Mittlerweile ist der NHS allerdings primär Quelle von Frustration, weil er nicht mit den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung mithalten kann. Die Wartezeiten für Gesundheitsleistungen werden immer länger, sie sind eine unerträgliche Zumutung. 7,4 Millionen Bürger warteten im September in England während im Mittel 13 Wochen auf einen Termin beim Facharzt.
Die Zustände sind unhaltbar. Es fehlt überall an Geld. Der riesige Staatsbetrieb, der allein in England 1,5 Millionen Mitarbeiter beschäftigt, ist kaum führbar. Labour müsste die vermehrte Nutzung privater Anbieter und eine grosszügigere Finanzierung ermöglichen. Doch die Regierung schiebt wie ihre Vorgänger und wie die Regionalregierungen von Schottland und Wales kostspielige und schwierige Reformideen auf die lange Bank.
Die etablierten Parteien sind am Ende
Das chronische Versagen der Politik in diesen vier Politikfeldern scheint für immer mehr Wähler den Schluss nahezulegen: Es liegt nicht nur an einzelnen unfähigen Ministern, sondern an den beiden grossen Parteien, welche diese hervorbringen. Die alten Eliten und ihre Ideen sind verbraucht. Sie haben das Vertrauen der Bürger verspielt. Sie bringen das Land nicht mehr voran.
Deshalb scheinen die Wähler heute zu einem radikalen Neubeginn bereit: Wären morgen Parlamentswahlen, würde laut Umfragen die Reform UK eine überwältigende Mehrheit im Unterhaus gewinnen. Ihr schillernder Parteichef Nigel Farage würde Premierminister. Die Partei wurde erst vor sieben Jahren gegründet, damals noch unter dem Namen Brexit Party. Ihr Erfolg wäre der grösste Bruch mit der politischen Tradition des Landes seit hundert Jahren, während deren sich stets Tories und Labour in der Regierungsverantwortung abwechselten.
Die Haltung, es nach all den Enttäuschungen und der Stagnation mit etwas Neuem zu versuchen, ist nachvollziehbar. Bis zur nächsten Wahl spätestens 2029 ist es allerdings noch eine lange Zeit. Es ist eine offene Frage, ob sich die vom eigenen Erfolg überraschte Reform UK bis dann zu einer ernsthaften Regierungspartei entwickeln wird, der die Wähler die nötigen Reformen zutrauen.
Riesige Herausforderungen für die Reform UK
Die Popularität der Reform UK liegt derzeit primär in dem Versprechen, die Einwanderung zu beenden beziehungsweise umzukehren. Hier verfügt die neue Partei und besonders ihr Führer Nigel Farage über die grösste Glaubwürdigkeit; schliesslich war es der Aussenseiter Farage, der sein politisches Leben lang dafür kämpfte und 2016 die Brexit-Abstimmung zum Erfolg führte.
Aber kann die Reform UK neben der Migrationsfrage auch die Strukturprobleme des Landes lösen? Noch deutet nichts darauf hin. Das Wahlprogramm von 2024 enthielt illusorische Versprechungen über Steuersenkungen und Ausgabenkürzungen, von denen sich Farage erst kürzlich zu distanzieren begonnen hat. Dabei hat die Reform UK das Problem, dass besonders viele ihrer Anhänger in strukturschwachen Regionen leben und von staatlichen Transfers abhängig sind – wie soll so eine Sanierung der Staatsfinanzen gelingen?
Hinzu kommt ein Mangel an erfahrenen Politikern und Funktionären, die sich der inhärenten Trägheit der Ministerialbürokratie entgegenstellen könnten. Eine so rasch aufsteigende Partei zieht oft auch zwielichtige Figuren an. Erst letzte Woche wurde ein kurzzeitiger Parteichef in Wales wegen der Annahme von Bestechungsgeldern des russischen Staats zu einer Gefängnisstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt.
Labour und die Konservativen befinden sich im selbstverschuldeten Niedergang. Die Reform UK hat noch gut dreieinhalb Jahre Zeit, um sich als echte Alternative aufzustellen. Für Nigel Farage bedeutet dies eine Mammutaufgabe. Für die Wähler und das Land ist zu hoffen, dass es ihm zumindest gelingen wird, die alteingesessenen Parteien gehörig unter Druck zu setzen.