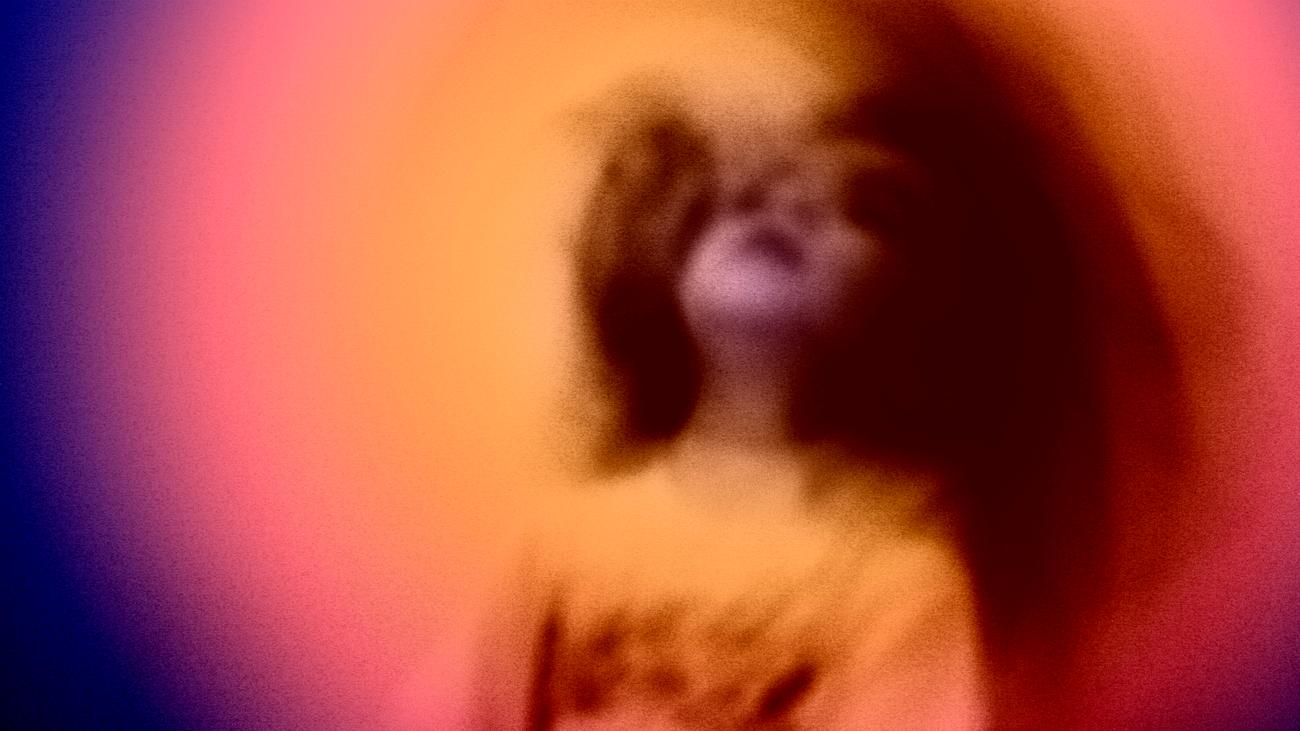Kunst in Museen muss einiges aushalten.
Aktivisten, die sich ankleben, altkluge Studentinnen, die mit Wikipedia-Wissen
ihre Dates beeindrucken wollen, und natürlich Kinder, die von Eltern auf
pädagogischer Mission durch die Ausstellungen gezerrt werden. Und in den vergangenen Jahren, da schien die Belästigung von Gemälden als Protestform kein
Ende zu nehmen. In München wurde damals etwa der wertvolle Rahmen eines Rubens
beschädigt, in Potsdam beschmierte man die Verglasung eines Monets mit
Kartoffelbrei, und im Oktober 2020 wurden auf der Berliner Museumsinsel gleich
63 Ausstellungsstücke gleichzeitig attackiert.
Mit vermutlich weniger
aktivistischer Agenda hat ein kleines Kind nun kürzlich ein Gemälde in einem
Museum in Rotterdam zerkratzt: Mark Rothkos Grau, Orange auf Kastanienbraun,
Nr. 8 mit einem Marktwert von schlappen 50 Millionen Euro. Einen Teil davon
könnte das Werk wegen der sichtbaren Kratzer im unteren Bereich nun eingebüßt haben.
Nun kommen Fragen auf: Wer ist schuld? Und natürlich: Wer
zahlt? Muss ein Kleinkind zeit seines Aufwachsens sein Taschengeld an ein
niederländisches Museum überweisen? Wir haben bei einem Kunstanwalt, einer
staatlichen Gemäldesammlung und einer Versicherungsangestellten nachgefragt, wie die Rechtslage in
Deutschland wäre. Sie alle eint ihre erste, schnelle Antwort: „Es kommt drauf
an.“ Professor Jan Hegemann ist Rechtsanwalt in der Berliner Kanzlei Raue und spezialisiert auf rechtliche Fragen im Bereich Kunst. Gut möglich
sei es, dass die Eltern des Kindes ihre
Aufsichtspflicht verletzt hätten. Anders gesagt: In
unmittelbarer Nähe zu derart hochwertiger Kunst darf man sein Kind nicht aus den Augen lassen.
„Aber nun ja, shit happens“, lautet die juristische
Facheinschätzung des Anwalts. Medienberichten zufolge war das Kind in Rotterdam keine fünf
Jahre alt. „Hätte ein Teenager achtlos eine Flasche Cola über den Rothko
gekippt, wäre die Sache eine andere.“ Aber wenn so ein kleines Kind, „das noch
keinen Begriff von Gut und Böse hat, ein Gemälde beschädigt, dann ist es auch
nicht strafbar“.
Wie vermittelt man seinem Nachwuchs denn auch, dass es etwa im
Malkurs in der Kita gut sei, draufloszukritzeln, heilsam sogar, wie die Kinderpsychologie
es nennen würde? Hier hingegen wäre das gleiche Verhalten böse – auch wenn Rothkos Farben zur eigenen Beteiligung mindestens genauso
einladen wie Mandalas in der eigenen heimischen Bastelecke. Ab einem gewissen Alter sollte man allerdings wissen, wann Kunst interaktiv ist und die eigene Bastelschere zum
Einsatz kommen darf und wann stumme Ehrfurcht vor einem millionenschweren Werk im Mindestabstand geboten ist.
© ZEIT ONLINE
Newsletter
Natürlich intelligent
Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt.
Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement.
Strafrechtlich ist das Kind also fein raus, zivilrechtlich könnte
es dennoch eng werden: Muss man für die Restaurierung eines Rothkos aufkommen,
wird’s Weihnachten eher mau unter Baum. 2011 war im selben Museum ein
Tourist aus Versehen auf das Kunstwerk Peanut-Butter Platform von Wim T.
Schippers getreten. Zu seiner Verteidigung kann man vorbringen, dass es sich
bei dem Werk um eine äußerst parkettähnliche Schicht
Erdnussbutter handelte, die in die Mitte eines Saals geschmiert war – zahlen
musste der Tourist am Ende trotzdem.
Einem möglichen Verteidiger der Familie empfiehlt Hegemann „das
genaue Hingucken“, ob vielleicht auch das Museum nicht alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat: „Warum ging keine Alarmanlage los, als das Kind sich dem
Gemälde näherte? Warum hing da keine Kordel, stand da kein Podest?“ Kurzes
Innehalten. „Na ja, wobei, darüber wäre ein tollpatschiges Kind im Zweifel auch
gestolpert.“ Vor allem ob der Summe der durch die Beschädigung entstandenen
Wertminderung sorgt sich Hegemann: „Wenn Rothko noch leben würde, wäre es halb
so wild. Er könnte es selbst ausbessern. Jetzt werden es Restauratoren für ihn
reparieren müssen. Die sind bestimmt kompetent. Aber eben nicht Rothko.“
Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kind für den Schaden nicht aufkommen muss: In einem
Museum in Haifa zerdepperte letzten August ein Vierjähriger eine 3.500
Jahre alte Vase, da war der Urheber etwas länger tot als Rothko. Trotzdem stellte die
Institution „die Vase einfach wieder her“, wie die BBC schreibt – der Junge
musste nichts bezahlen und erhielt wenige Tage nach dem Vorfall sogar eine persönliche
Führung durch das Museum. Zur Beruhigung seines schlechten Gewissens, er habe
scheinbar besonders große Reue gezeigt. Seinem niederländischen
Schicksalsgenossen würde die eine oder andere schuldbewusste Träne also
sicherlich gut zu Gesicht stehen.
In den staatlichen Museen Deutschlands hilft keine Träne
und kein Gott. Hier werden Metaphysik der Kunst und kleinkindliche Naivität von
den Ansprüchen des Fiskus getrumpft: „Versuchen Sie mal, vor den Steuerzahlern
zu rechtfertigen, dass sie für die Restaurierung aufkommen müssen“, sagt eine
Sprecherin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, und man meint das Kopfschütteln mitzuhören. „Es muss schon priorisiert werden, wofür Steuern eingesetzt
werden.“
Und in privaten Sammlungen? Normalerweise sei Kunst in
deutschen Museen und Galerien gegen alles versichert, was nicht „explizit
ausgeschlossen ist, zum Beispiel Krieg, innere Unruhen, Radioaktivität“, sagt
die Leiterin der Kunstabteilung des Maklers Helmsauer Gruppe. Ist das Kind also
nicht zufällig mit waffenfähigem Uran durch die Galerie gelaufen, wäre es also
auf der sicheren Seite. „Die meisten Schäden entstehen ohnehin in banalen
Situationen, beim Transport oder eben durch unvorsichtige Besucher.“ Die Haftpflichtversicherung
der Eltern müsste vielleicht trotzdem obendrauf zahlen.
Es kommt also einiges zusammen: die Intentionen des
Kindes, sein scheinbar noch nicht ausgebildetes Verständnis
moralphilosophischer Dilemmata, die fehlenden Sicherheitsmaßnahmen des Museums
sowie Fragen der Autorenschaft, der Versicherung und der spezifischen
Rechtslage in den Niederlanden. Das Museum sucht seit dem Vorfall händeringend ein
Team aus internationalen Restauratoren. Wer für deren Mühen aufkommen soll, das
Museum oder das Kind mit ungefähr all seinen noch kommenden Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken
zusammen, diese Entscheidung kann sich noch Jahre hinziehen. Offen bleibt weiterhin, ob dieses Kleinkind mit der Attacke auf Rothkos Kunst sein frühes Bekenntnis zu abstrakter Kunst ausdrückt – oder zum politischen Aktivismus. Dafür fehlt ihm nur noch der Kartoffelbrei.