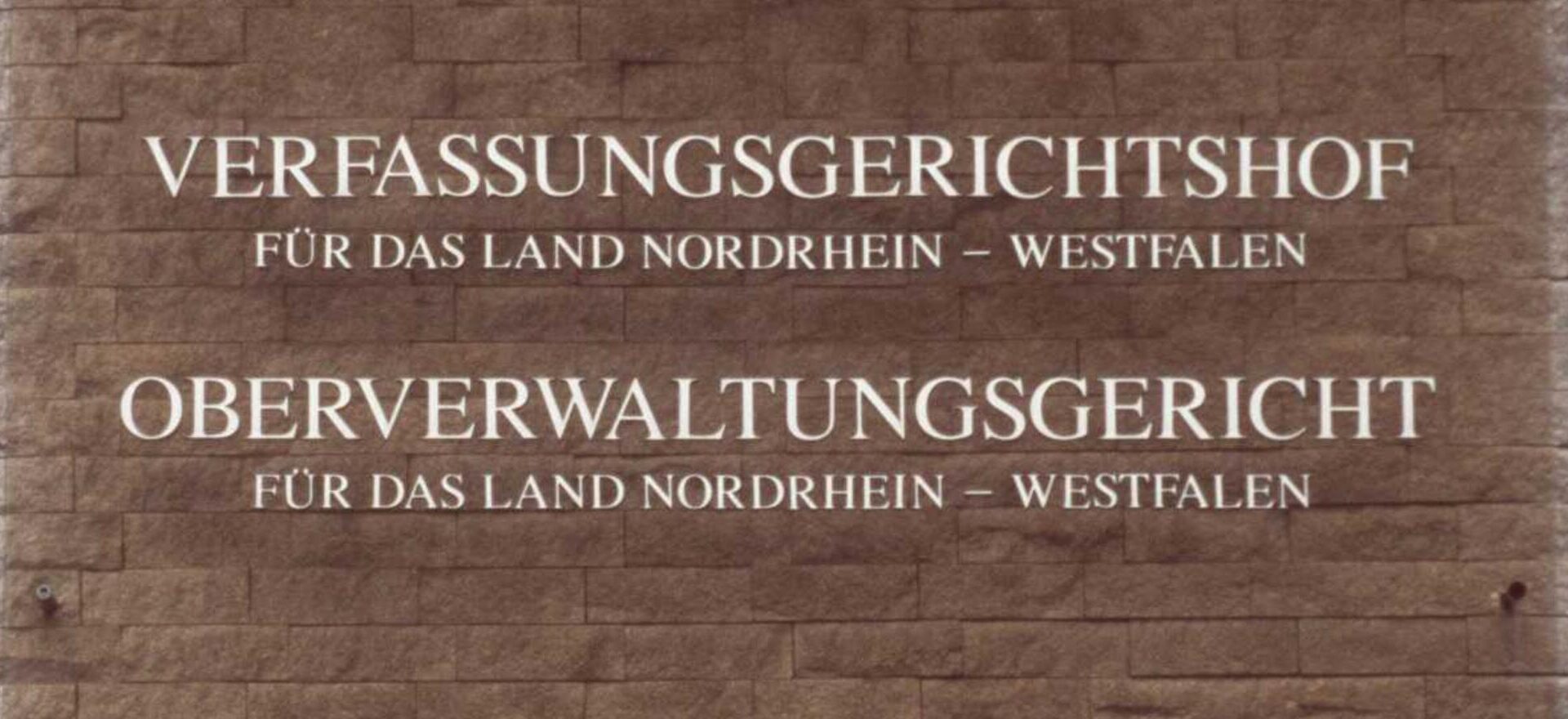Das OVG Münster hat geurteilt, dass AfD-Mitglieder nicht automatisch als unzuverlässig gelten. Das sagt ein Waffenrechtsexperte …
Im Spannungsfeld zwischen politischer Betätigung und waffenrechtlicher Zuverlässigkeit hat sich eine neue Wegmarke herausgebildet. Nachdem das Verwaltungsgericht Düsseldorf mit Urteilen vom 19.06.2024 (Az. 22 K 4836/23 und 22 K 4909/23) und vom 24.06.2024 (Az. 22 K 6153/23) die bloße Mitgliedschaft in der AfD als ausreichend für eine Regelunzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b WaffG gewertet hatte, ist nun das Oberverwaltungsgericht Münster eingeschritten – und hat die Entscheidungen vom 19.06.2024 und vom 24.06.2024 korrigiert. Doch nur wenige Tage später folgt die nächste Zäsur: Die AfD-Bundespartei wird seit dem 2. Mai 2025 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft.
Rückblick: VG Düsseldorf – Verdachtsfall reicht aus
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschied in den oben genannten Fällen, dass bereits die Mitgliedschaft in einer als „Verdachtsfall“ eingestuften Partei (damals: AfD NRW bzw. Bundespartei) die Regelvermutung der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. b WaffG auslöst. Die Urteile begründen dies damit, dass bereits eine Verdachtslage ausreiche, wenn sie auf Erkenntnissen des Bundesamts für Verfassungsschutz fuße. Eine individuelle Gefährdung oder konkrete Aktivitäten des Betroffenen innerhalb der Partei hielten die Richter nicht für erforderlich.
OVG Münster: Verdachtsfall allein genügt nicht – Differenzierung zwingend
Das OVG Münster hat mit zwei Beschlüssen vom 30.04.2025 (Az. 20 B 948/24 und 20 A 1506/24) diese pauschalen Bewertungen ausdrücklich verworfen. Es hob die Entscheidungen des VG Düsseldorf auf und stellte klar: Eine waffenrechtliche Unzuverlässigkeit kann nicht allein auf die Mitgliedschaft in einer Partei gestützt werden, die vom Verfassungsschutz lediglich als Verdachtsfall eingestuft ist.
Die zentralen Argumente des OVG sind:

1. Fehlende „gesicherte Erkenntnisse“ genügen nicht: Die Vorschrift des § 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b WaffG verlangt, dass „Tatsachen die Annahme rechtfertigen“, die Person sei in den letzten fünf Jahren Mitglied einer Vereinigung gewesen oder habe eine solche unterstützt, die ihrerseits in dieser Zeit nachweislich eine der in § 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a WaffG genannten Bestrebungen verfolgt hat. Dabei genügt es nicht, wenn die Organisation lediglich als „Verdachtsfall“ vom Verfassungsschutz eingestuft wurde. Nach zutreffender Auffassung des OVG Münster reicht eine solche Einstufung gerade nicht aus, da sie gerade keinen gesicherten Tatsachenkern bildet, sondern lediglich auf einer vorläufigen Bewertung beruht. Die verfassungsfeindlichen Bestrebungen der Organisation müssen vielmehr mit der erforderlichen Deutlichkeit für die zuständige Behörde und im Streitfall für das Gericht feststehen. Nur dann kann die Mitgliedschaft in einer solchen Vereinigung als Grundlage für die Annahme der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit dienen.
2. Rechtsstaatlicher Maßstab – Differenzierung notwendig: Das Gericht betont den verfassungsrechtlichen Schutz der Vereinigungsfreiheit und politischen Betätigung (Art. 9 und 21 GG). Der Staat dürfe diese Grundrechte nicht durch pauschale Rückschlüsse auf eine etwaige Verfassungsfeindlichkeit aushöhlen. Eine bloße Parteimitgliedschaft – selbst in einer vom Verfassungsschutz beobachteten Partei – reiche nicht aus, um einem Bürger das waffenrechtliche Vertrauen abzusprechen. Vielmehr sei stets im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob die betroffene Person tatsächlich selbst extremistische Bestrebungen unterstützt oder sich aktiv daran beteiligt.
3. Keine Umkehrung der Beweislast: Ein zentrales rechtsstaatliches Argument des Gerichts betrifft die Beweislastverteilung. Der Staat muss im verwaltungsrechtlichen Verfahren die Voraussetzungen für eine behördliche Maßnahme – hier die Annahme der Unzuverlässigkeit – darlegen und beweisen. Würde man bereits beim Verdachtsfall die Regelvermutung greifen lassen, müsste sich der Betroffene faktisch entlasten, also seine Verfassungstreue beweisen. Eine solche Beweislastumkehr widerspricht dem rechtsstaatlichen Grundprinzip, wonach der Staat alle belastenden Tatsachen selbst beweisen muss. Die Behörde kann sich nicht auf einen bloßen Verdacht zurückziehen und dem Betroffenen die Last der Widerlegung aufbürden.
4. Abgrenzung zur gesicherten Extremismus-Einstufung: Das OVG Münster zieht eine scharfe Grenze zwischen der Einstufung als „Verdachtsfall“ und der Bewertung als „gesichert extremistische Bestrebung“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Nur im letztgenannten Fall – also dann, wenn eine Organisation nachweislich und durch gesicherte Erkenntnisse verfassungsfeindlich ist – könne die waffenrechtliche Regelvermutung des § 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b WaffG überhaupt greifen. Nur dann ist auch eine auf objektiv überprüfbaren Tatsachen gegründete Annahme im Sinne des Gesetzes möglich. Im Fall eines bloßen Verdachts sei die Regelvermutung nicht anwendbar.
5. Ermessensbindung bei Regelvermutung nicht schematisch: Auch im Fall einer formal greifenden Regelvermutung – etwa bei einer als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuften Organisation – fordert das OVG eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall. Die Behörde dürfe nicht schematisch die waffenrechtliche Zuverlässigkeit verneinen. Der Ausschluss der Zuverlässigkeit sei nur gerechtfertigt, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein Unterstützen verfassungsfeindlicher Strukturen vorlägen. Beispiel hierfür ist, wenn der Betroffene etwa durch sein Verhalten – etwa durch Funktionsträgerschaften, aktive Mitwirkung, öffentliche Äußerungen oder anderweitige Unterstützung – tatsächlich Anlass zu waffenrechtlichen Bedenken gegeben hat. Pauschale Verbote seien mit den Grundrechten nicht vereinbar.
Neue Entwicklung: AfD jetzt „gesichert rechtsextremistisch“
Nur zwei Tage später, am 2. Mai 2025, informierte das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass es die AfD-Bundespartei nun als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ einstuft. In der Pressemitteilung heißt es, die Anhaltspunkte hätten sich „verdichtet“. Die Partei richte sich nach Einschätzung der Behörde erwiesenermaßen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Grundlage sei ein mehr als 1.000 Seiten umfassendes Gutachten, das insbesondere Verstöße gegen das Menschenwürdeprinzip, den demokratischen Rechtsstaat und die Gleichheit vor dem Gesetz dokumentiere. Damit endet die bisherige Einstufung als „Verdachtsfall“ der Bundespartei. Die rechtliche Tragweite dieser Bewertung ist erheblich – auch für das Waffenrecht.

Waffenrechtliche Konsequenz: Rückkehr zur Regelvermutung?
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. b WaffG sieht vor, dass bei Mitgliedern von Vereinigungen, die Bestrebungen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG verfolgen, die Unzuverlässigkeit vermutet wird, sofern die Mitgliedschaft Tatsachen zufolge gegeben ist. Mit der neuen Bewertung durch den Verfassungsschutz könnte die AfD nun als eine solche Organisation gelten. Die Regelvermutung greift also, sofern die Parteimitgliedschaft nachgewiesen ist – und keine Umstände vorliegen, die den Einzelfall aus der Regel herausheben.
Das OVG Münster hat in seinen Entscheidungen deutlich gemacht, dass selbst bei einer „gesicherten extremistischen Bestrebung“ nicht automatisch jede Mitgliedschaft zur Unzuverlässigkeit führt. Vielmehr sei Raum für eine verfassungsrechtlich gebotene Abwägung, insbesondere dann, wenn sich der Betroffene innerhalb der Partei von extremistischen Tendenzen distanziert habe oder keinerlei aktive Beteiligung festzustellen sei.
Keine Entwarnung, aber auch kein Automatismus
Die Waffenbehörden werden die neue Lage zweifellos aufgreifen. Wer der AfD angehört – sei es passiv oder aktiv –, muss künftig mit intensiveren waffenrechtlichen Überprüfungen und möglicherweise dem Entzug von Erlaubnissen rechnen. Entscheidend bleibt aber: Nicht jede Mitgliedschaft führt zwangsläufig zum Verlust der Zuverlässigkeit. Es bleibt eine Einzelfallentscheidung – auch wenn die rechtlichen Hürden für eine positive Prognose nun erheblich gestiegen sind.
Fazit
Die Entscheidungen des OVG Münster haben dem juristisch motivierten Automatismus einen Riegel vorgeschoben und verfassungsrechtlich gebotene Differenzierung eingefordert. Doch mit der Neubewertung der AfD als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ durch den Verfassungsschutz hat sich die Ausgangslage dramatisch verändert. Die Waffenbehörden stehen vor einer neuen Bewertungslage, in der nunmehr die Regelvermutung wieder an Bedeutung gewinnt. Für Betroffene bedeutet das: Wer Mitglied der AfD ist, muss künftig aktiv darlegen, warum er trotz dieser Zugehörigkeit waffenrechtlich zuverlässig sein soll. Die Rechtsprechung ist aufgerufen, die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit neu auszutarieren – der 3. Akt hat gerade erst begonnen und die weitere Entwicklung bleibt rechtlich wie politisch brisant.