Bei Fotografien ist derjenige, der sie aufgenommen hat, zumeist unsichtbar, zumindest vor dem Zeitalter der Selfies. Erscheint er auf seinen Bildern, so ist das meist unwillkürlich geschehen, etwa in Gestalt seines Schattens oder einer Reflexion in einem aufgenommenen Objekt. Es nimmt kaum wunder, dass sich unter den rund zwei Millionen Fotografien, die in der DDR im Zuge der Bespitzelung durch die Stasi entstanden sind und akribisch archiviert wurden, nur wenige finden, die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) zeigen. Sie standen auf der anderen Seite der Kamera.
Philipp Springer hat vor einigen Jahren mit dem Bildband „Der Blick der Staatssicherheit“ eine Art Album vorgelegt, das eine Auswahl von Fotos zeigt. Sie wirken ohne Kontext meist enigmatisch und manchmal nachgerade surreal, zeigen merkwürdige Gegenstände und Ausschnitte, aber auch Tatorte und Grenzräume. Der Schrecken des Überwachungsregimes ist hier nicht Gegenstand, sondern Fotografie gewordene Methode. Nun legt Springer das Pendant dieser Auswahl vor und führt uns den Arbeitsalltag im MfS sowie einen kleinen Reigen der teilweise namentlich identifizierten Angestellten vor Augen. Kann man ihren Namen eruieren, so stellt er anhand der Kaderakten auch knapp ihre Geschichte vor.
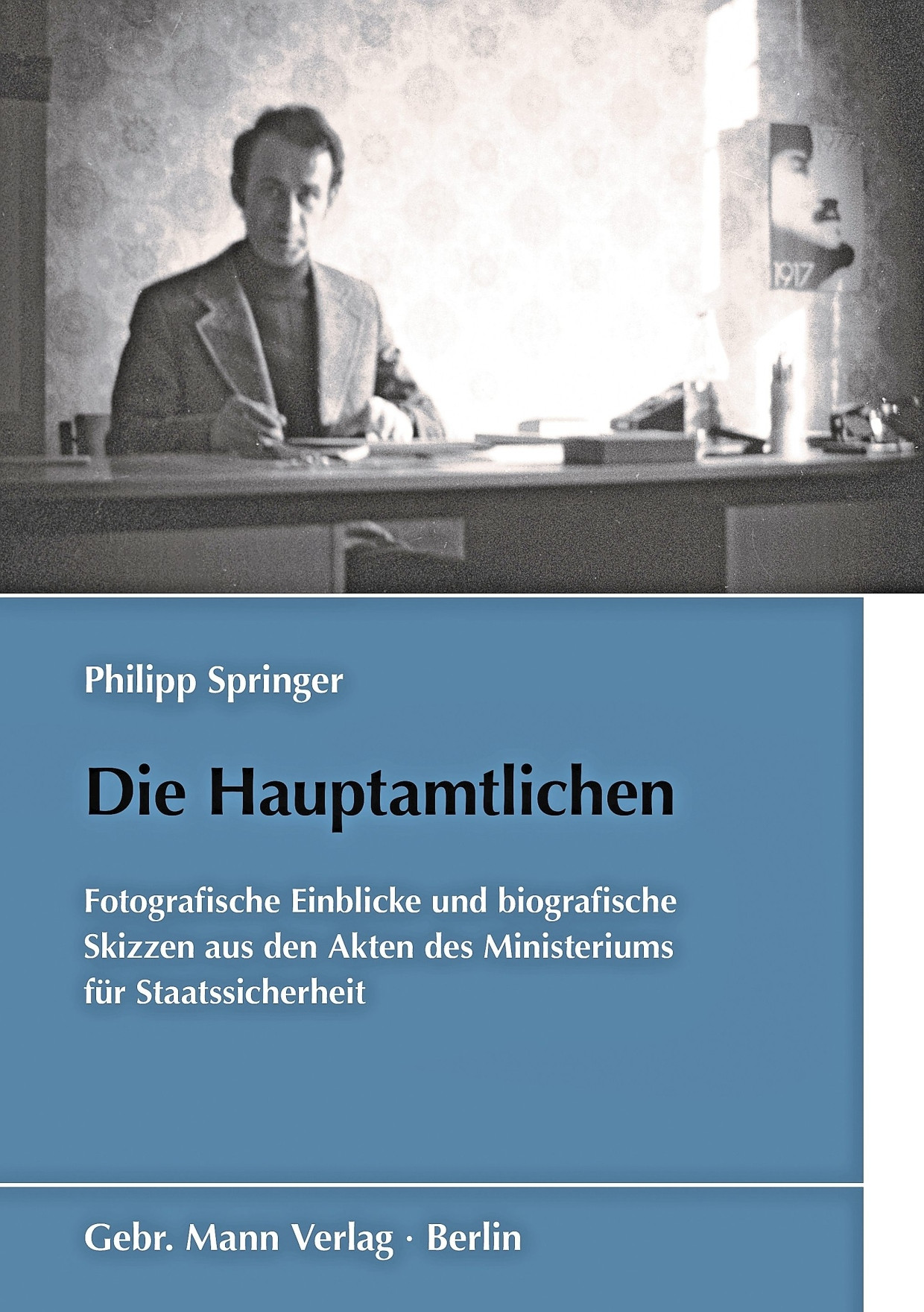 Philipp Springer: „Die Hauptamtlichen“. Fotografische Einblicke und biografische Skizzen aus den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit.Gebr. Mann Verlag
Philipp Springer: „Die Hauptamtlichen“. Fotografische Einblicke und biografische Skizzen aus den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit.Gebr. Mann Verlag
Viele der Aufnahmen sind zufällig oder zum Spaß aufgenommen worden und ähneln zahllosen Schnappschüssen dieser Zeit, die Menschen bei der Arbeit zeigen. Sie sind fade und banal, fotografisch ohne Belang und allenfalls durch die beiläufig mitaufgenommenen Accessoires von Interesse. Wir sehen das „Neue Deutschland“ auf dem Schreibtisch, marxistisch-leninistische Literatur im Regal, aber auch Fotos von Kakteen und jungen Frauen an der Wand. Letztere entpuppen sich bei Lektüre des Kommentars als Werbeplakat für die Praktica-Kamera des VEB Pentacon.
Springer versucht diese bewusst armen Fotos zum Sprechen zu bringen, indem er den im Bild hinterlassenen Spuren nachgeht und die Fotografie als „Errettung der äußeren Wirklichkeit“ im Sinne Siegfried Kracauers ernst nimmt. In den Einzelbildern soll nicht nur der Habitus der Aufgenommenen, sondern die Struktur des Apparats, für den sie arbeiten, ablesbar werden. Das ist trotz einer leichten Tendenz, die semantische Aufladung der Fotos zu hoch anzusetzen, ungemein instruktiv.
Da fotografische Aufnahmen im MfS untersagt waren, sind solche Bilder nur selten Teil des Archivs geworden. Anders verhält es sich, wenn sogenannte „Neuerervorschläge“ präsentiert werden. Wir sehen Manfred Fleischer, der das sowjetische Innenraumüberwachungssystem „Nyrok“ testet, oder schauen auf Major Klaus Wöllner, wie er in das Zoom-Fernrohr „Negus“ schaut, das eine Personenobservierung aus einer Entfernung von vierhundert Metern gestattete. Und wir sehen die „Handschließmaschine HSM 86“ zur Kontrolle von Briefen, aber auch Menschen, die verschiedene „Fotomasken“ vorstellen: Geheimkameras, die in der Tasche einer Arbeiterlatzhose, einem Motorradhelm oder „Plastekorb“, einer selbstgenähten Jeansjacke oder in einem Campingbeutel versteckt waren. Wir sehen die konspirative Wohnung „Argus“ und inszenierte „Übergabevarianten“ von Geheimdokumenten mit Agenten, bei denen der angeklebte Bart und die Perücke nicht fehlen dürfen. Wüssten wir nicht um den bitteren Ernst der Geschichte, so könnte man sie für Film Stills von Agentenkomödien halten. Aber bereits Marx merkte ja einmal an, dass geschichtliche Tragödien als Farce wiederkehren können.
Philipp Springer: „Die Hauptamtlichen“. Fotografische Einblicke und biografische Skizzen aus den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit. Gebr. Mann Verlag, Berlin 2025. 248. S., Abb., geb., 59,– €.
