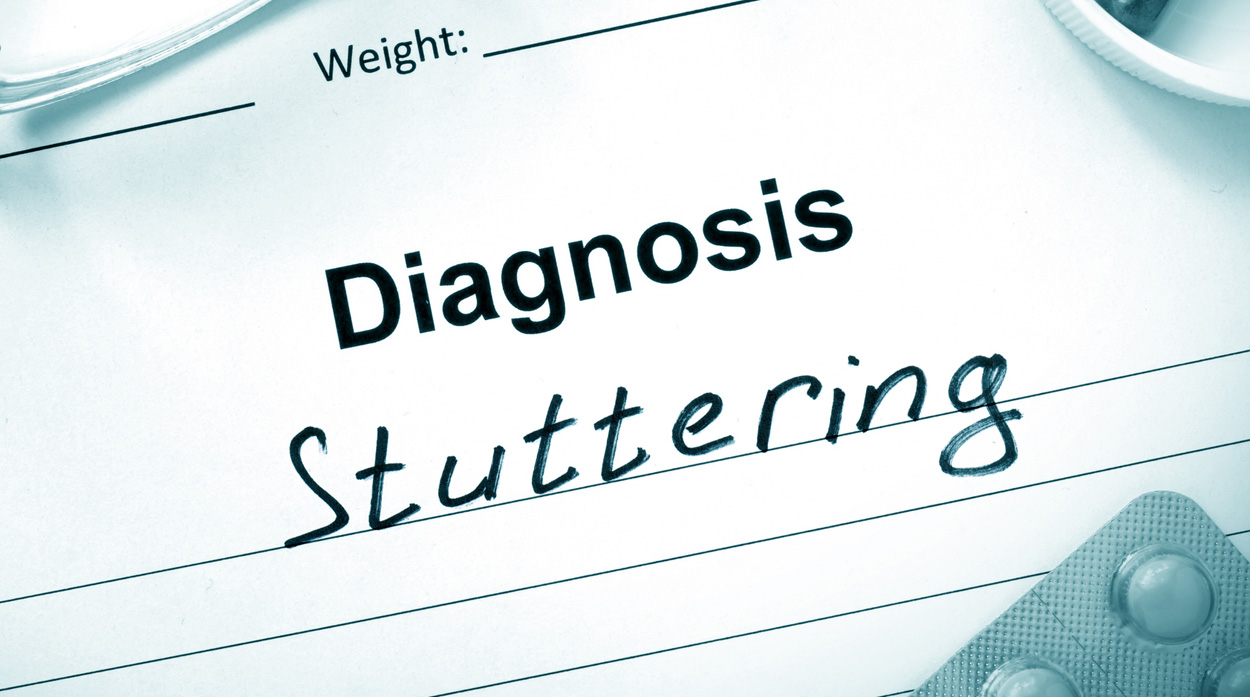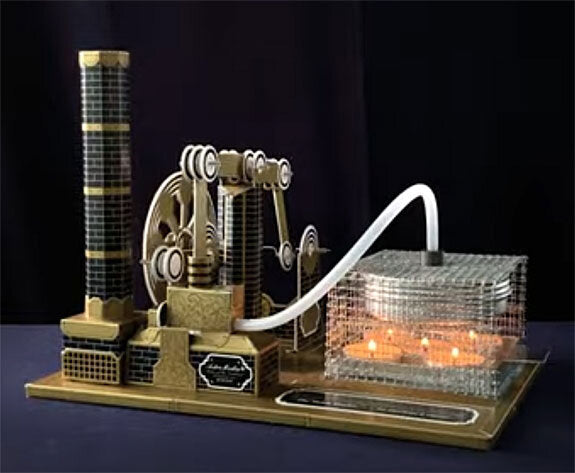Wer stottert, leidet oft unter erheblichen sozialen Einschränkungen. Nun haben Forschende mit einer genomweiten Assoziationsstudie 48 Gene identifiziert, die mit dem Stottern in Verbindung stehen. Die Ergebnisse deuten auf einen genetischen Zusammenhang zu anderen Erkrankungen wie Autismus und Depressionen hin. Auch ein Gen, das für das Rhythmusgefühl verantwortlich ist, weist bei stotternden Menschen typischerweise Variationen auf. Die neuen Erkenntnisse können dazu beitragen, die Stigmatisierung Betroffener zu verringern. Zudem könnten sie zur Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze beitragen.
Mit mehr als 400 Millionen Betroffenen weltweit ist Stottern die häufigste Sprachflussstörung. Typische Ausprägungen sind Silben- und Wortwiederholungen, Lautverlängerungen und Pausen zwischen den Wörtern. Meist tritt die Störung im Alter von zwei bis fünf Jahren erstmals auf, wobei das Problem bei 80 Prozent der Kinder spontan oder begleitet von Sprachtherapie verschwindet. In einigen Fällen bleibt das Stottern allerdings bis ins Jugend- und Erwachsenenalter bestehen, insbesondere bei Männern. Obwohl bereits bekannt ist, dass Stottern vererbt werden kann, sind die Ursachen noch weitgehend unklar.
Genetischen Risikofaktoren auf der Spur
„Niemand versteht wirklich, warum jemand stottert; es ist ein völliges Rätsel. Und das gilt für die meisten Sprach- und Sprechstörungen. Sie sind stark unterforscht, weil sie niemanden ins Krankenhaus bringen, aber sie können enorme Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen haben“, sagt Jennifer Below von der Vanderbilt University in Tennessee. „Wir müssen die Risikofaktoren für Sprach- und Sprechstörungen verstehen, damit wir sie bei Kindern frühzeitig erkennen und diejenigen, die es wünschen, angemessen behandeln können.“ Gemeinsam mit einem Team um Erstautorin Hannah Polikowsky hat Below daher die genetischen Daten von fast 100.000 Stotternden und mehr als einer Million Kontrollpersonen analysiert.
Dabei identifizierten die Forschenden 57 Stellen auf 48 Genen, die bei stotternden Menschen verändert sind. Anhand von zwei unabhängigen Kohorten bestätigte das Team, dass die genetischen Variationen in diesen Bereichen tatsächlich mit einem erhöhten Risiko für Stottern in Verbindungen stehen. „Seit Jahrhunderten gibt es falsche Vorstellungen darüber, was Stottern verursacht – von Linkshändigkeit über Kindheitstraumata bis hin zu überfürsorglichen Müttern“, sagt Below. „Unsere Studie zeigt, dass Stottern nicht durch persönliche oder familiäre Versäumnisse oder Intelligenz verursacht wird, sondern durch unsere Gene beeinflusst wird.“
Zusammenhang mit Rhythmus und Musikalität
Unter den identifizierten Genen sind einige, die laut in früheren Studien auch an anderen Erkrankungen beteiligt sind, darunter Autismus und Depressionen. Da Männer häufiger bis ins Erwachsenenalter hinein von Stottern betroffen sind als Frauen, untersuchten die Forschenden die genetischen Daten auch nach Geschlechtern getrennt. Dabei stellten sie fest, dass bei stotternden Männern typischerweise ein Gen namens VRK2 verändert ist, das bereits früher mit unserem Rhythmusgefühl in Verbindung gebracht wurde. Variationen in diesem Gen können früheren Studien zufolge dazu führen, dass Betroffene Schwierigkeiten haben, im Takt zu klatschen.
„In der Vergangenheit haben wir Musikalität, Sprache und Sprechen als drei separate Einheiten betrachtet, aber diese Studien deuten darauf hin, dass es eine gemeinsame genetische Grundlage geben könnte. Die Architektur des Gehirns, die unsere Musikalität, unser Sprechen und unsere Sprache steuert, könnte Teil eines gemeinsamen Pfades sein”, sagt Below. „Es ist unglaublich spannend, auf biochemischer, molekularer und zellulärer Ebene zu verstehen, was uns als Spezies ausmacht – unsere Kommunikationsfähigkeit. Wir hoffen, dass dies weitere Studien zu diesem Gen und seiner Funktion im Gehirn anregen wird.“
Ihr Kollege und Co-Autor Dillon Pruett, der selbst stottert, ergänzt: „Es gibt viele unbeantwortete Fragen zum Stottern, und als jemand, der persönlich davon betroffen ist, wollte ich einen Beitrag zu dieser Forschung leisten. Unsere Studie hat ergeben, dass es viele Gene gibt, die letztlich zum Stotter-Risiko beitragen, und wir hoffen, dieses Wissen nutzen zu können, um das Stigma im Zusammenhang mit Stottern zu beseitigen und hoffentlich in Zukunft neue therapeutische Ansätze zu entwickeln.“
Quelle: Hannah Polikowsky (Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA) et al., Nature Genetics, doi: 10.1038/s41588-025-02267-2

Bauen Sie Ihre eigene Dampfmaschine! Hochwertiger Bausatz aus stabilen Materialien, inkl. Anleitung. Ab 14 Jahren, 5-10 Stunden Bastelspaß. Erleben Sie Dampfkraft live!
€ 39,90