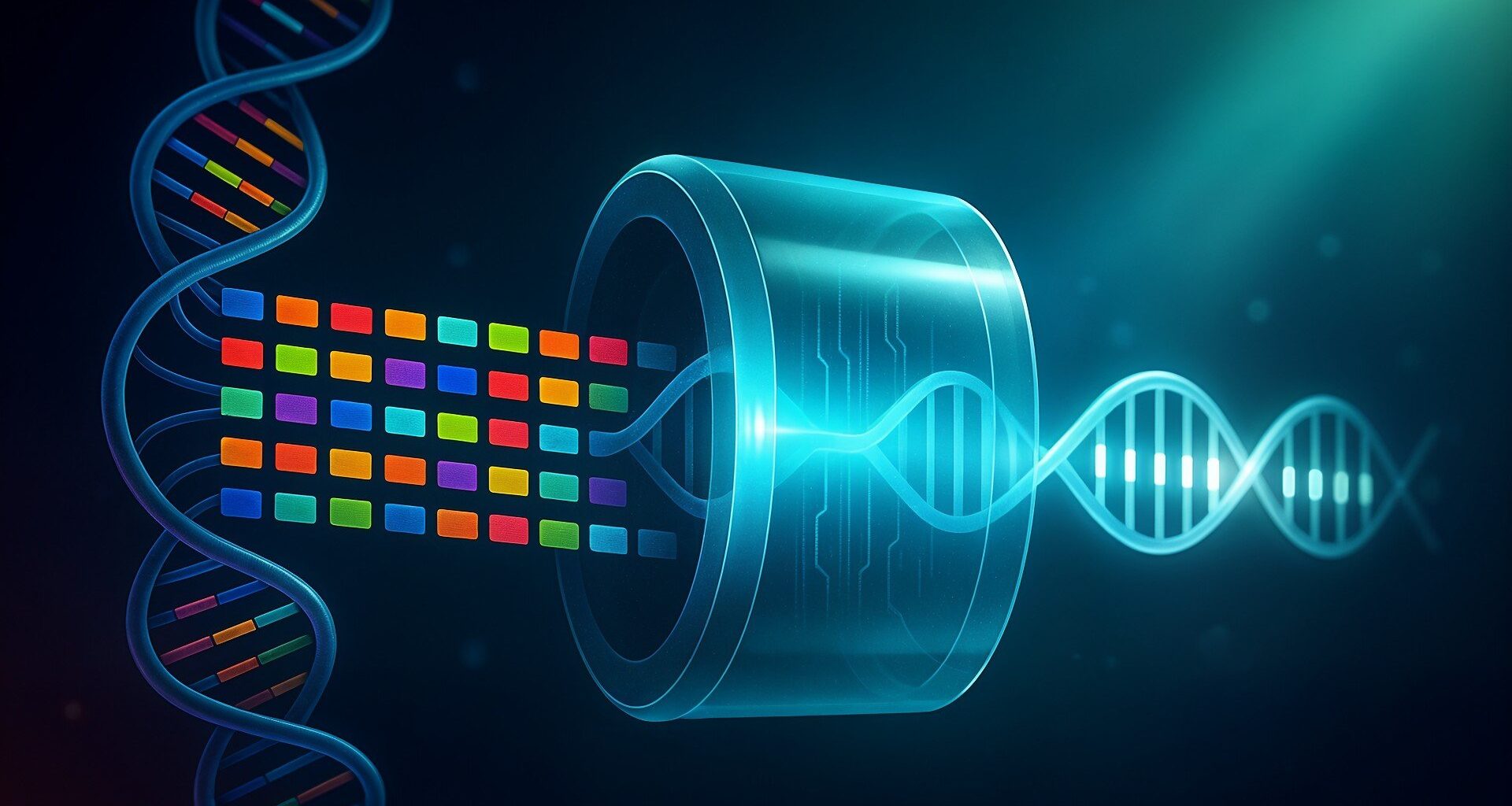Forscher haben den genetischen Code von E. coli drastisch vereinfacht: Von 64 auf 57 Codons – ein synthetischer Minimalcode, den das Leben nie vorsah und der neue Anwendungen in Biotechnologie und Pharma möglich machen soll.
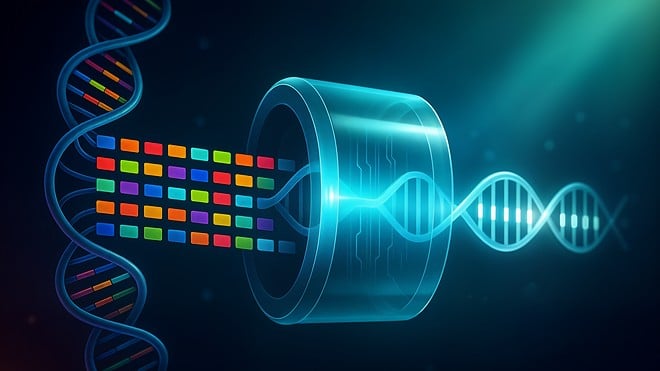
Genetische Redundanz extrem reduziert
Es erinnert an Informatik: Ein Algorithmus erkennt Wiederholungen in einem Datensatz und ersetzt sie durch kürzere Symbole. Die Datei bleibt funktional gleich – aber sie wird kompakter, effizienter, eleganter. Etwas ganz Ähnliches ist nun Biologen gelungen. Sie haben den genetischen Code von E. coli so weit gestrafft, dass nur noch 57 der üblichen 64 Codons nötig sind, um Leben zu ermöglichen.
Schon seit Jahrzehnten fasziniert Biologen die Frage, ob die genetische Redundanz in der DNA tatsächlich eine Funktion erfüllt – oder ob sie nur ein Überbleibsel der Evolution ist. Denn obwohl es 64 mögliche Codons gibt – also Dreierkombinationen aus DNA-Bausteinen – codieren sie letztlich nur 20 verschiedene Aminosäuren.
Im genetischen Code kommt es daher zu Dopplungen: So wie in der Sprache „Auto“, „Wagen“ und „Fahrzeug“ denselben Inhalt vermitteln, gibt es auch im Erbgut verschiedene „Wörter“ für dieselbe Aminosäure. Diese Redundanz ist biologisch weitverbreitet – doch ist sie auch wirklich notwendig? Genau das wollten Forscher jetzt herausfinden, indem sie den Code gezielt verschlankten.
Schon 2019 reduzierte ein Team um Jason Chin das Genom eines E. coli-Bakteriums auf 61 Codons. In einem neuen Projekt gingen sie noch weiter: Für die Variante „Syn57“ ersetzten sie sechs gängige Codons und ein Stoppsignal durch funktional identische Alternativen – in über 101.000 gezielten Eingriffen. Jeder dieser Eingriffe wurde auf seine Auswirkungen geprüft, Segment für Segment. Ein Prozess, der an hochpräzise Softwareentwicklung erinnert: testen, debuggen, validieren.
Der dabei entstandene Organismus wächst langsamer – etwa viermal langsamer als sein Vorgänger – doch er lebt, verarbeitet Proteine korrekt und zeigt ein „charakteristisches Genexpressionsprofil“. Das deutet auf umfassende physiologische Anpassungen hin, ausgelöst allein durch Änderungen im „Codierstil“.
Neu codiertes Leben
Was aber bringt ein derart neu codiertes Leben? Die Forscher sprechen von einem neuen genetischen „Gestaltungsspielraum“ – in Regionen, die durch natürliche Evolution nicht erschlossen wurden. Praktisch bedeutet das: Solche Organismen könnten gegen Viren immun sein, weil die virale DNA ihre Proteine nicht mehr korrekt codieren kann.
Das macht diese Zellen besonders interessant für die Biotechnologie: etwa in der Herstellung von Medikamenten, Impfstoffen oder Enzymen, bei denen Virusbefall in Produktionsprozessen ein ernstes Problem ist. In solchen Hochsicherheitsumgebungen könnten neu codierte Mikroorganismen helfen, Ausfallrisiken zu senken und die Produktionsqualität zu erhöhen.
Außerdem eröffnet sich die Möglichkeit, neue Aminosäuren oder sogar vollkommen neue genetische Bausteine zu gestalten – zum Beispiel für die Herstellung maßgeschneiderter Enzyme, Proteine oder synthetischer Polymere mit Eigenschaften, die in der Natur nicht vorkommen.
Wo einsetzen?
Laut den Forschern ein weiterer Vorteil: Diese Organismen sind gezielt verändert und dadurch besser kontrollierbar. Weil sie nur noch einen eingeschränkten, exakt definierten Satz an Codons verwenden, lassen sie sich wie biologische Minimalsysteme betreiben – standardisiert, vorhersagbar und sicher. Das ist besonders wichtig für geschlossene oder sicherheitskritische Umgebungen – etwa in Biosensoren oder in der Raumfahrt. Einfach gesagt: Je weniger biologische „Eigenwilligkeit“ ein System mitbringt, desto verlässlicher lässt es sich steuern.
Doch es bleibt eine offene Frage: Wie viel Reduktion verträgt ein lebendes System noch, bevor es seine Funktionsfähigkeit verliert? Die Forscher sind optimistisch. Ihr Ansatz sei kein Einzelfall, sondern ein Beispiel dafür, wie synthetische Biologie systematisch neue Lebensformen entwerfen kann – nach Prinzipien, die an die Softwarewelt erinnern.
Was ist Gentechnik?
Gentechnik bezeichnet einen Wissenschaftszweig, der sich mit der gezielten Veränderung des Erbguts von Organismen beschäftigt. Dabei werden Gene isoliert, neu kombiniert oder modifiziert, um bestimmte Eigenschaften zu beeinflussen oder neue zu schaffen.
Je nach Anwendungsbereich unterscheidet man zwischen „roter Gentechnik“ (Medizin), „grüner Gentechnik“ (Landwirtschaft) und „weißer Gentechnik“ (industrielle Produktion). Die Techniken reichen von klassischen Verfahren bis hin zu modernen Methoden wie CRISPR/Cas.
Wie funktioniert CRISPR/Cas?
CRISPR/Cas ist eine präzise „Genschere“, die DNA an vorbestimmten Stellen schneiden kann. Das System stammt ursprünglich aus Bakterien, die es als Abwehrmechanismus gegen Viren nutzen.
Bei der Anwendung wird eine Leit-RNA (guide RNA) eingesetzt, die zur Ziel-DNA-Sequenz passt und das Cas-Enzym gezielt dorthin führt. An dieser Stelle schneidet das Enzym die DNA, wodurch Gene ausgeschaltet, verändert oder neue DNA-Abschnitte eingefügt werden können – schneller und kostengünstiger als mit früheren Methoden.
Welche Vorteile bietet Gentechnik?
In der Medizin ermöglicht Gentechnik die Herstellung wichtiger Medikamente wie Insulin oder Impfstoffe und eröffnet neue Therapiemöglichkeiten für Erbkrankheiten und Krebs. Diese Anwendungen sind gesellschaftlich weitgehend akzeptiert.
In der Landwirtschaft können gentechnisch veränderte Pflanzen potenziell höhere Erträge liefern, widerstandsfähiger gegen Schädlinge, Krankheiten oder klimatische Bedingungen sein und zur Schonung von Ressourcen beitragen. Die industrielle Biotechnologie nutzt gentechnisch veränderte Mikroorganismen zur umweltfreundlichen Produktion.
Welche Risiken bestehen?
Bei gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in der Umwelt besteht das Risiko der unkontrollierten Ausbreitung und möglicher Einkreuzung in Wildpflanzen oder konventionelle Kulturen. Dies könnte negative Auswirkungen auf Ökosysteme und die Artenvielfalt haben.
Kritiker befürchten zudem unbeabsichtigte Nebenwirkungen durch sogenannte „Off-Target-Effekte“ sowie gesundheitliche Risiken durch gentechnisch veränderte Lebensmittel. Auch die zunehmende Abhängigkeit von Saatgutkonzernen und ethische Fragen, besonders bei Eingriffen in die menschliche Keimbahn, werden diskutiert.
Wie ist Gentechnik reguliert?
In Deutschland regelt das Gentechnikgesetz (GenTG) den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen. Es schreibt strenge Zulassungsverfahren, Risikobewertungen und Kennzeichnungspflichten vor, besonders für die Freisetzung und das Inverkehrbringen von GVO.
Die EU-Gesetzgebung verfolgt dabei einen vorsorgenden Ansatz. Aktuell wird über eine Neuregulierung der sogenannten „Neuen genomischen Techniken“ wie CRISPR/Cas diskutiert, wobei besonders die Frage im Raum steht, ob einfache Genveränderungen ohne Fremd-DNA anders behandelt werden sollten als klassische Gentechnik.
Gentechnik gegen den Welthunger?
Befürworter argumentieren, dass gentechnisch veränderte Pflanzen durch höhere Erträge und Widerstandsfähigkeit gegen Klimastress zur Ernährungssicherheit beitragen könnten. Mit neuen Verfahren wie CRISPR/Cas ließen sich angepasste Sorten deutlich schneller entwickeln.
Kritiker wenden ein, dass Hunger primär ein Verteilungsproblem sei und nicht durch Technologie allein gelöst werden könne. Sie verweisen darauf, dass bisherige GV-Pflanzen hauptsächlich für industrialisierte Landwirtschaft in wohlhabenden Ländern entwickelt wurden und nicht für kleinbäuerliche Strukturen in Entwicklungsländern.
Wie steht die Gesellschaft dazu?
In Deutschland steht die Bevölkerung der Gentechnik in der Landwirtschaft überwiegend skeptisch gegenüber. Laut Umfragen lehnen etwa 80 % der Deutschen gentechnisch veränderte Lebensmittel ab, unabhängig von Bildungshintergrund und Einkommen.
Die medizinische Anwendung der Gentechnik („rote Gentechnik“) wird hingegen deutlich positiver bewertet. Bei neuen Verfahren wie CRISPR/Cas herrscht noch große Unkenntnis – nur etwa 21 % der Befragten kannten laut einer europäischen Umfrage den Begriff „Genomeditierung“.
Gentechnik vs. konventionelle Zucht?
Die konventionelle Züchtung basiert auf natürlicher Variation und Kreuzungen zwischen verwandten Arten, während Gentechnik gezielt einzelne Gene verändern oder artfremde Gene einbringen kann. Neue Verfahren wie CRISPR/Cas verschwimmen diese Grenzen teilweise.
Befürworter betonen, dass auch die konventionelle Zucht seit Jahrtausenden das Erbgut verändert und dass manche Züchtungsmethoden wie Mutationszüchtung durch Bestrahlung ebenfalls massive, aber ungezielt verteilte DNA-Veränderungen verursachen. Kritiker hingegen sehen fundamentale Unterschiede in der Eingriffstiefe und möglichen Risiken.
Zusammenfassung
- Forscher reduzierten den genetischen Code von E. coli auf 57 statt 64 Codons
- Die Frage nach der Funktion genetischer Redundanz steht im Forschungsfokus
- In über 101000 gezielten Eingriffen wurden sechs Codons gezielt ersetzt
- Der modifizierte Organismus wächst langsamer, bleibt aber lebensfähig
- Neu codierte Mikroorganismen könnten gegen Virusbefall immun sein
- Die Technologie eröffnet Möglichkeiten für maßgeschneiderte Enzyme
- Reduzierte genetische Systeme sind besser kontrollier- und standardisierbar
Siehe auch: