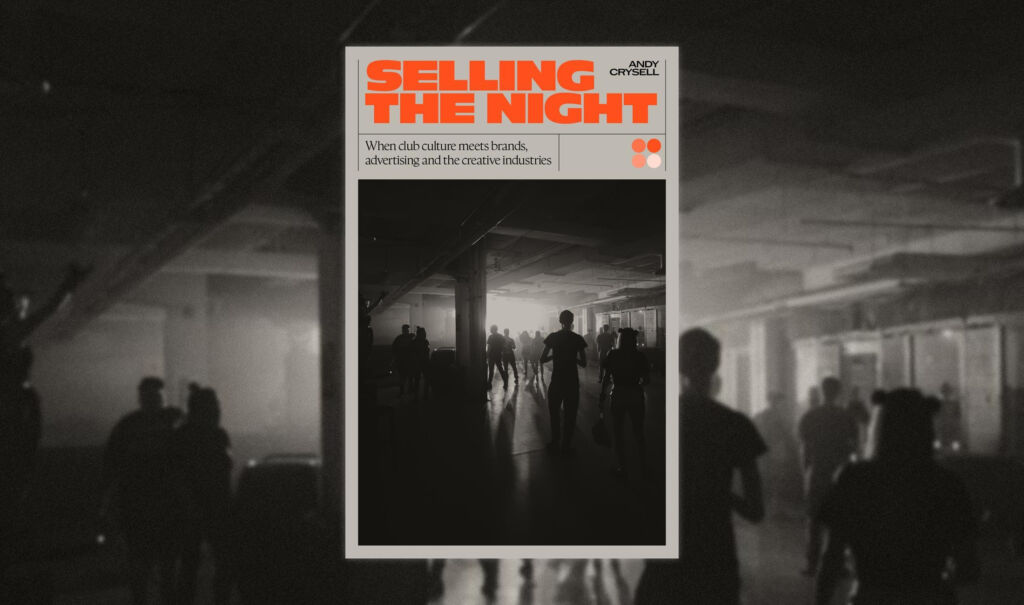Der ehemalige Musikjournalist und heutige Marketing-Stratege Andy Crysell hat ein Buch über die Verflechtungen von Werbebranche und Clubkultur geschrieben. Es will zwischen Großkapital und Underground vermitteln – und liefert damit einen wichtigen Beitrag.
Nachdem der Private-Equity-Gigant KKR im vergangenen Jahr den Großveranstalter Superstruct samt seines Festival-Portfolios aufgekauft hat, wird in diesem Sommer viel über den Einfluss des Großkapitals auf die internationale Clubszene diskutiert. Zwischen Boykottaufrufen gegen Superstruct-Festivals wie Field Day in London und Sónar in Barcelona wird allerdings nur selten herausgezoomt. Die finanzkapitalistischen Verflechtungen der Musikwelt sind eben komplexer, als es sich in einer Instagram-Story oder auch einem noch so langen Substack-Post adäquat darstellen ließe.
Andy Crysell hat darüber kein Buch geschrieben. Und doch könnte Selling the Night. When Club Culture Meets Brands, Advertising and the Creative Industries (Velocity Press) das Bewusstsein dafür schärfen, welche Wechselwirkungen zwischen großem Geld und kleiner Szene seit jeher bestehen. Crysell spricht mit Autorität und Empathie für beide Perspektiven, hat er doch lange Zeit als Musikjournalist gearbeitet und verdient mittlerweile sein Geld als Marketing-Stratege, der unter anderem für Ballentine’s mit und in der Clubszene gearbeitet hat. Das fast 400 Seiten lange, englischsprachige Buch richtet sich also an beide Seiten.
Crysell gliedert Selling the Night thematisch in acht Kapitel auf, entspinnt in seinem Verlauf jedoch eine mit überraschenden Einsichten gespickte Chronologie. Bereits in der Disco-Ära kollaborierte die Modemarke Fiorucci mit dem Studio54, während der schwedische Vodka-Hersteller Absolut die Nähe zur schwulen Community New Yorks suchte, ist schon auf den ersten Seiten zu erfahren. So geht es weiter, werden nach und nach Fallbeispiele wie die Red Bull Music Academy bis hin zum von Jägermeister eingerichteten Fonds Best Nights VC vorgestellt. Das Fazit: Wo Clubs öffneten, weckte das immer schon Konzerninteressen.
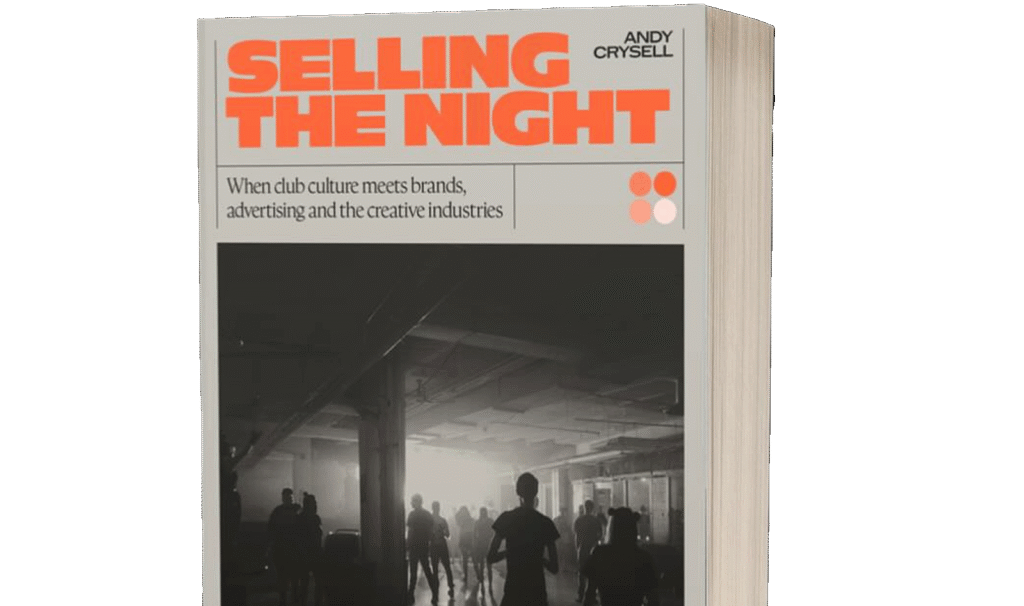 © Velocity PressWidersprüche allenthalben
© Velocity PressWidersprüche allenthalben
Es geht Crysell indes um mehr als die Geschichtsschreibung der Annäherung zwischen Markenartiklern und dem Dancefloor. Ebenso beleuchtet er Paradigmenwechsel im Zusammenspiel zwischen beiden, erklärt, wie PlayStation DJs noch vor dem Influencer-Zeitalter mit Konsolen versorgte und wie sich die Videospielserie WipEout inklusive Soundtrack als perfekter Coup erwies: Das Spiel bewarb die Musik und vice versa. Auch den Einstieg von Jägermeister in die Szene und die Einrichtung des Best-Nights-Fonds erläutert er und stellt das sogar in den Kontext von Debatten über öffentliche Förderung.
Crysell macht damit – bisweilen durchaus mit eindeutig kritischem Ton – Clubkids verständlich, wie unentwirrbar die Verbindungslinien zwischen szenefremden Branchen und ihrer Subkultur verheddert sind. Und unterstreicht obendrein, dass die Grenzen im Rahmen des Aufkommens der sogenannten Kreativindustrie mithin komplett verschwimmen – wofür seine eigene Biografie ja ebenfalls einen deutlichen Beweis liefert. Zugleich lässt er Einwänden gegenüber dieser graduellen Verzahnung und den mannigfaltigen Konflikten in diesem wilden Durcheinander viel Raum.
Doch ist Selling the Night ebenso als Handbuch für die Marketing-Abteilungen großer Unternehmen zu verstehen, die sich gerne neue Absatzmärkte erschließen oder zumindest ihre eigene Brand mit dem Rave-Lifestyle assoziieren möchten. Wann immer Crysell über Klassenunterschiede und Intersektionalität schreibt, wird es dementsprechend ambivalent. Sicherlich versucht er aus den besten Beweggründen heraus ein Bewusstsein für sozioökonomische Schieflagen und unterschiedliche Marginalisierungsformen zu schaffen. Derlei Passagen lassen sich genauso gut als schematische Zielgruppensegmentierung lesen.
Es verwundert allerdings kaum, dass sich ein Autor, der hier oder dort marxistische Kulturtheorie zitiert und den Begriff „Neoliberalismus“ mit dezidiert negativem Anklang verwendet, in Widersprüchlichkeiten begibt – unterstreicht Selling the Night doch im Ganzen, wie die Widersprüche des Kapitalismus das Miteinander von Marken und Clubkultur prägen. Dass die Etats der ersteren der zweiteren bei der Umsetzung innovativer Konzepte durchaus behilflich sein können, steht nach der Lektüre zumindest fest. Aber auch, dass viel Skepsis herrscht und die Buy-in-Versuche einiger Marken mal peinlich, mal schädlich waren.
 © Donny Jiang/UnsplashNicht ohne Interessenkonflikte
© Donny Jiang/UnsplashNicht ohne Interessenkonflikte
Auffällig ist, dass Crysell nicht nur als Fan von bestimmten Player:innen der Clubszene schreibt, sondern auch sehr affirmativ über bestimmte Marketing-Initiativen schreibt. Über die Red Bull Music Academy heißt es, dass sich über deren Arbeit „allgemein positiv“ geäußert worden sei. Selbst seinem vorigen Arbeitgeber Ballentine’s bescheinigt Crysell, dass über dessen Boiler-Room-Kollaboration True Music die Annahme vorherrsche, diese habe sich „seit ihrem Launch in 2014 positiv entwickelt“. Hand aufs Herz: Wer hat je in der Raucherecke mit der neuen Rave-Bekanntschaft über True Music diskutiert? Eben.
Der Interessenkonflikt geht über die bloße Beschreibung der Marketing-Maßnahmen früherer oder gar zukünftiger Arbeitgeber hinaus. Selling the Night kann aus vermarkterischer Perspektive nur dann wirklich einen Mehrwert haben, wenn darin Best-Practice-Beispiele präsentiert werden. Dabei gelegentlich über das Ziel hinauszuschießen, untermauert umso mehr die Existenzberechtigung des Buchs. Deshalb wird anscheinend manches trotz aller Nuanciertheit – die Kritik am ehemaligen Red-Bull-Geschäftsführer Dietrich Mateschitz unterschlägt Crysell keineswegs – etwas rosiger dargestellt, als es in Wirklichkeit wohl ist.
Dazu gehört auch, dass Crysell seinen zahlreichen Interview-Partner:innen mehr Platz einräumt, als ein wirklich strenges Lektorat ihm zugestanden hätte. Wohlgemerkt gilt das für beide Seiten und also einander widersprechenden Perspektiven, die gezielt miteinander kontrastiert werden. Das erlaubt einen kritischen Zugang zu den Themen, mit denen sich Crysell in Selling the Night auseinandersetzt, und kann Stoff liefern für weitere Debatten. Das macht es nicht nur angesichts der derzeitigen Aufregung um Private-Equity-Investitionen in der Szene, sondern auch deren allgemeinen Boom zu einem wichtigen Debattenbeitrag.
Das Miteinander von nuancierten Analysen, jeder Menge Marketing-Sprech und Kapitalismuskritik sorgt für produktive Verwirrung: Crysell redet von Ausverkäufen und verdeutlicht die Verkaufspotenziale von Clubkultur als „strategischem Asset“, wie es eine Interviewpartnerin nennt. Doch tut er das mit Empathie für die Belange einer Szene, die ihre Ideale nur ungern verkaufen will – bisweilen aber von Kompromissen profitieren kann. Selling the Night empfiehlt sich also als Geschichte voller Widersprüche; als Einladung dazu, sich mit der Komplexität der Gemengelage angemessen auseinanderzusetzen.
„Selling the Night. When Club Culture Meets Brands, Advertising and the Creative Industries“ von Andy Crysell ist bei Velocity Press erschienen.