Einer der Männer trägt den Flicken falsch herum auf seiner Uniform. Oben gelb, unten blau. Doch sein ukrainischer Kamerad rückt das schnell wieder gerade. Oben das Blau des Himmels, darunter das Gelb des Weizens. So ist es richtig. Dass die Symbolik noch etwas Übung braucht, ist kein Wunder. Vor einigen Wochen lebte der Rekrut noch am anderen Ende der Welt. Die Ukraine kannte er nur aus Geschichten und den Videos auf seinem Smartphonebildschirm.
Er ist einer der vielen Kolumbianer, die aufseiten der ukrainischen Armee gegen Russland kämpfen. Mit einer Handvoll Kameraden sitzt er in einer Art Kantine im umkämpften Norden des Gebiets Charkiws. Auch die Küchenfrauen sind Kolumbianerinnen. Zu Mittag gibt es ein Reisgericht mit Hühnchen aus der Heimat. Die Soldaten dienen in der „Guajiro“-Einheit der 13. Chartija-Brigade. La Guajira ist eine Provinz in Kolumbien. Der Name geht auf die Herkunft des ersten getöteten Kolumbianers in dieser Brigade zurück.
Die Vereinbarung mit der Familie daheim
Am Vormittag haben die Rekruten im Wald ein paar Grundlagen gelernt. Wie man das Sturmgewehr UAR-15, eine ukrainische Version eines amerikanischen Gewehrs, auseinanderschraubt. Dazu taktische erste Hilfe, Bewegungsabläufe bei feindlichem Beschuss. Die Lehrstunden sind auch auf Spanisch, kaum einer der Männer spricht ein Wort Englisch. Geschweige denn Ukrainisch.
 Der Krieg als Broterwerb: Kolumbianische Kämpfer der 13. Chartija-Brigade in ihrem Wohnhaus nahe CharkiwDaniel Pilar
Der Krieg als Broterwerb: Kolumbianische Kämpfer der 13. Chartija-Brigade in ihrem Wohnhaus nahe CharkiwDaniel Pilar
Der Ausbilder ist einer von ihnen. Der kleine Mann mit breitem Lächeln heißt Mai. Seit rund einem Jahr lebt er in der Ukraine. Hier hat er den ersten Schnee seines Lebens gesehen. Der Mann kommt aus der Hauptstadt Bogota. Früher war er Soldat in der kolumbianischen Armee. Über den Krieg in der Ukraine hat er im Internet erfahren, Jobsuche eben. Mai war in der Ukraine erst Teil eines Sturmtrupps, der feindliche Gräben einnimmt. Dort wurde er zum Unteroffizier befördert – und schließlich zum Ausbilder. Seine Vereinbarung mit der Familie daheim ist klar: Drei Jahre Krieg, dann will er wieder zurück sein. Mit dem nötigen Geld auch für die Bildung der Kinder. Heimatbesuche sind nicht geplant. Seine Frau und die Kinder sieht er nur einmal am Tag – im Videotelefonat. Sie sprechen immer gegen Mittag, dann ist es in Kolumbien früh morgens – und die Kinder sind noch nicht zur Schule losgegangen.
Auch Mai spricht weder Englisch noch Ukrainisch. Mit den ukrainischen Ausbilderkollegen unterhält er sich auf Spanisch. Im Land fühlt er sich wohl. „Manchmal, wenn man in Uniform unterwegs ist, sprechen einen Leute auf der Straße an und bekunden ihren Respekt“, erzählt er. Seine Reise an die Front war ein großes Wagnis. Er war sich nicht sicher, ob die Armee ihn aufnehmen würde. Monatelang hatte er für die Flugtickets gespart, die ihn über Spanien und Polen in die Ukraine brachten.
Die Verantwortlichen der Brigade sagen, sie seien sich des Problems mit der Finanzierung bewusst. Sie arbeiten daran, den Rekruten die Möglichkeit zu geben, die Anreise mit ihren ersten Monatsgehältern abzuzahlen. Gerade aber sei das nicht möglich. Wenn nicht doch mal wieder einer von ihnen aus eigener Tasche etwas vorstreckt.
Niemand kann sie zum Bleiben zwingen
Da die Chartija-Brigade zur ukrainischen Nationalgarde gehört, bekommen sie keine Mobilisierten ab. Sie mussten sich nach Möglichkeiten der freiwilligen Rekrutierung umsehen – und sind so auf Ausländer gekommen. Sie unterteilen sie hier in zwei Gruppen: Neben den Guajiros gibt es noch „die Demokraten“. Das meint Freiwillige aus westlichen Ländern. Bei denen gibt es keine Finanzierungsprobleme bei der Anreise. Sie kommen meist auch nicht wegen des Geldes, sondern aus Überzeugung. Und sie machen Probleme: durch Nachfragen, Beschwerden, Gegenvorschläge. Demokratisch eben.
 Dokumentieren mit dem Smartphone: Ausbilder Mai während eines Trainings mit dem SchnellfeuergewehrDaniel Pilar
Dokumentieren mit dem Smartphone: Ausbilder Mai während eines Trainings mit dem SchnellfeuergewehrDaniel Pilar
Den Verantwortlichen macht das viel Arbeit. Im Krieg aber braucht es Effizienz – und eine klare Befehlsstruktur. Anders als die ukrainischen Kämpfer haben die Ausländer eine Wahl. Niemand kann sie zum Bleiben zwingen. Deshalb verlassen manche nach kurzer Zeit ihre Einheiten – oder gleich das Land. Vor allem die Demokraten, denen ihr Leben besonders teuer erscheint.
Die Guajiros bleiben der Brigade meist treu – sie gelten als folgsam und weniger diskussionsfreudig. Genaue Zahlen sind geheim, man geht aber davon aus, dass rund 40 Prozent der ausländischen Kämpfer in der ukrainischen Armee spanische Muttersprachler sind. Fast alle davon kommen aus Südamerika, die meisten aus Kolumbien, es gibt aber auch viele Brasilianer. In der westlichen Medienberichterstattung spielen sie trotzdem höchstens eine Nebenrolle. Dort werden in der Regel freiwillige „Kriegshelden“ aus den eigenen Ländern begleitet. In russischen Telegramkanälen, in denen ausländische Kämpfer für die Ukrainer bloßgestellt werden, sind die Südamerikaner dagegen großes Thema. Die Russen verbreiten persönliche Daten und Fotos aus sozialen Medien. Das soll einschüchtern.
Für die Brigade bringt die Arbeit mit den internationalen Teams nicht nur Vorteile. Die Arbeit im Stab beschreiben sie als chaotisch. Positionen werden in der Regel mit Personen mit der gleichen Muttersprache besetzt. In der Zentrale aber – wo alle Informationen zusammenlaufen – kommen dann zeitgleich ukrainische, russische, spanische und englische Funksprüche an. Noch dazu abgehackt und rauschig. Die Übersetzer haben alle Hände voll zu tun. Besonders die Armee-Bürokratie macht viel Arbeit. Die Kolumbianer können kein Dokument selbst lesen, sie kennen in der Regel ja nicht einmal die Bedeutung der kyrillischen Buchstaben. Die Kolumbianer sind keine klassischen Söldner, die für eine Firma tätig sind. Sie werden als reguläre Soldaten in die Armee eingegliedert. Ihr Sold unterscheidet sich nicht von dem Gehalt ukrainischer Armeeangehöriger.
Kämpfen, um daheim ein Haus zu bauen
Aus kolumbianischer Sicht aber sind die etwa 3000 Euro pro Monat viel Geld. An der Front bekommen sie Verpflegung und Unterkunft, müssen also kaum etwas davon ausgeben. Die meisten holen sich bei der Eröffnung des Bankkontos direkt mehrere Karten, erzählen sie hier. Eine davon behalten sie, die anderen schicken sie mit der Post nach Hause. Die Verwandten können dann schon während der Abwesenheit auf das Geld zugreifen. Viele Kämpfer sehen ihren Einsatz hier als eine Art Auslandsjahr. Sie sparen für ein konkretes Ziel wie ein neues Haus. Oder ein Auto, um ins Taxigewerbe einzusteigen.
Bei der Rekrutierung setzen sie bei Chartija auf Mundpropaganda. Der eine erzählt es dem nächsten, hilft im besten Fall noch bei der Organisation der Anreise. Zudem verbreiten sie Werbefotos in entsprechenden Whatsapp-Gruppen. Die Internetseite der Brigade lässt sich nicht nur auf Ukrainisch und Englisch, sondern auch auf Spanisch anzeigen. Ein Rekrutierer erzählt, andere Brigaden seien da noch besser aufgestellt. Sie hätten auch Rekrutierer in Kolumbien – und Plakatkampagnen.
In der Regel haben die kolumbianischen Kämpfer eine Vergangenheit in der heimischen Armee oder in den Milizen. Ein halbes Jahrhundert Bürgerkrieg hat viele Veteranen geschaffen. Sie kommen mit frisch ausgestellten Reisepässen, kaum einer war je zuvor im Ausland. Viele bringen Kampferfahrungen mit – allerdings aus einer völlig anderen Art der Kriegsführung. In Kolumbien wurden die Kombattanten mit Hubschraubern im Dschungel abgesetzt, um dann mit Sturmgewehren Jagd auf die FARC-Guerilla zu machen. Feste Positionen, Artilleriefeuer und Drohnenüberwachung lernen die meisten erst auf ukrainischem Boden kennen. Mitunter kommen auch frühere Rebellen.
Es gibt in der Heimat auch Russlandfreunde
Die Alternative in der Heimat wäre, für die Drogenkartelle zu arbeiten. Doch das birgt große Risiken, auch für die Familien. Die Brigade-Verantwortlichen erzählen, viele seien auch hier, um möglichen Racheakten in der Heimat zu entgehen. Die regierungstreuen Sicherheitskräfte hätten in den Neunzigerjahren die Drecksarbeit für die Regierung gemacht. Jetzt seien viele auf Rache aus.
 Identifikation per Tattoo: Ein kolumbianischer Kämpfer trägt das Wappen der Chartija-Brigade am HalsDaniel Pilar
Identifikation per Tattoo: Ein kolumbianischer Kämpfer trägt das Wappen der Chartija-Brigade am HalsDaniel Pilar
Einige der Kolumbianer nördlich von Charkiw sind dennoch vorsichtig. Sie wollen ihr Foto nicht in der deutschen Zeitung sehen. Sie wissen von den russischen Telegramkanälen, manche tauchten selbst schon dort ungewollt auf. Mitunter gebe es auch Drohungen über soziale Netzwerke. Diese stammten von früheren FARC-Rebellen, die Verbindungen nach Russland haben.
Eine politische Gefahr in ihrer Heimat bringe der Kampfeinsatz für Kiew aber nicht mit sich. Zwar gilt der linke Präsident Gustavo Petro, der selbst Teil einer Guerilla-Gruppe war, als Moskau zugewandt. So lehnte er Waffenlieferungen an Kiew wie die meisten anderen Südamerikaner deutlich ab. Die Tätigkeit für die Armee eines anderen Staates wird aber bislang nicht verfolgt. Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde aber schon angekündigt. Gefahr droht auch bei der Rückreise. Im Sommer vergangenen Jahres nahmen venezolanische Behörden kolumbianische Kämpfer fest, die über das Nachbarland zurückreisten. Sie wurden nach Russland überstellt. Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro hat enge Beziehungen zu Russland. Bei der Brigade raten sie deshalb deutlich von Zwischenstopps nach Venezuela ab.
Auch auf russischer Seite kämpfen Südamerikaner. Die Ukrainer erzählen, die Russen seien da nicht wählerisch. Am leichtesten sei das Rekrutieren für sie aber in Ländern, zu denen Moskau gute Beziehungen unterhält – vorzugsweise Venezuela. Warum es besonders Kolumbianer auf ukrainischer Seite sind, erklären sie sich hier mit dem starken amerikanischen Einfluss. Seit Beginn des Kalten Krieges hätten die Amerikaner den Kolumbianern den Hass auf die Kommunisten eingebläut. Dieser habe sich im Denken festgesetzt. Auch ohne richtiges Wissen, was das eigentlich ist. So sehen viele Venezuela, die Sowjetunion und Russland als Bedrohung an.
Selbst Medwedjew hat das Thema entdeckt
Nicht alle kommen mit genauen Vorstellungen über den Ukrainekrieg und seine Entstehung. Vor Ort aber halten dann alle die Verteidigung des Territoriums für eine gute Sache. Die meisten sehen den Auslandseinsatz aber wohl vor allem als persönliche Chance, die es zu Hause nicht gibt.
 Funken nur mit Übersetzer: Die kolumbianische Kämpferin Diamond im Wohnhaus der BrigadeDaniel Pilar
Funken nur mit Übersetzer: Die kolumbianische Kämpferin Diamond im Wohnhaus der BrigadeDaniel Pilar
Zuletzt häuften sich auch negative Berichte. Medien deckten auf, dass mexikanische Kartelle ihre Leute in die Ukraine schleusen, damit diese den Umgang mit „First Person View“-Drohnen lernen. Allerdings nicht für die ukrainische Landesverteidigung – sondern für den Drogenkrieg daheim. Ein Kommandeur des Bataillons Karpatska Sitsch begründete in einem Interview, warum es keine Kolumbianer mehr aufnimmt. Die wirklich professionellen Soldaten mit Motivation kämen kaum noch, nun seien es vor allem Bauern, die Geld verdienen wollten.
Auch die russische Propaganda hat das Thema für sich entdeckt. Der frühere Präsident Dmitrij Medwedjew schrieb jüngst auf Telegram, alles, wozu die Südamerikaner imstande seien, sei, „Zivilisten im Drogenrausch zu enthaupten“. Das „Bandera-Regime“ rekrutiere den übelsten „Abschaum der Menschheit“ für die Front.
In der Kantine sitzt auch eine junge Frau. Sie ist dünn, zart und hübsch. Ihr Name: Diamond. Abgesehen von der Armeekleidung sieht sie nicht wirklich nach Krieg aus. Doch in der Sache wirkt sie entschieden. Die frühere Polizistin hat die ersten Gehälter in ihre Ausrüstung investiert. Nun hat sie eine neue Splitterschutzweste und einen Helm. Die Ausrüstung der Armee war zu groß für ihren kleinen Körper. Jetzt kann das Geldverdienen also beginnen. In ein paar Tagen, sagt sie, geht es auf Position. Die Kolumbianer werden in der Regel in der Infanterie eingesetzt. Ganz vorn also, im trockenen Graben. Nur das Funkgerät verbindet sie mit dem Stab – wenn gerade ein Übersetzer da ist.
Quelle: F.A.Z.Artikelrechte erwerben
Empfehlungen
Ein Mord, der an Kolumbiens dunkle Zeit erinnert
Tjerk Brühwiller, São Paulo

Stellenmarkt
Verlagsangebot

Lernen Sie Englisch

Verkaufen Sie zum Höchstpreis
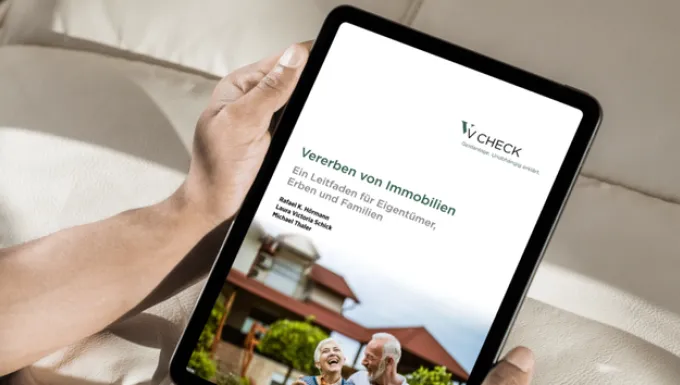
Immobilie vererben? Mit diesem E-Book häufige Fehler vermeiden!
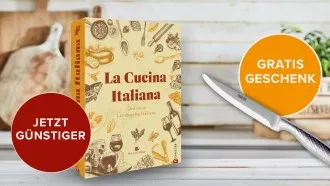
Legendäres Kochbuch günstiger & Messer gratis dazu!

Lernen Sie Französisch
Weitere Themen
Verlagsangebot
Services
Frankfurter Allgemeine Zeitung © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2001–2025
Alle Rechte vorbehalten.

