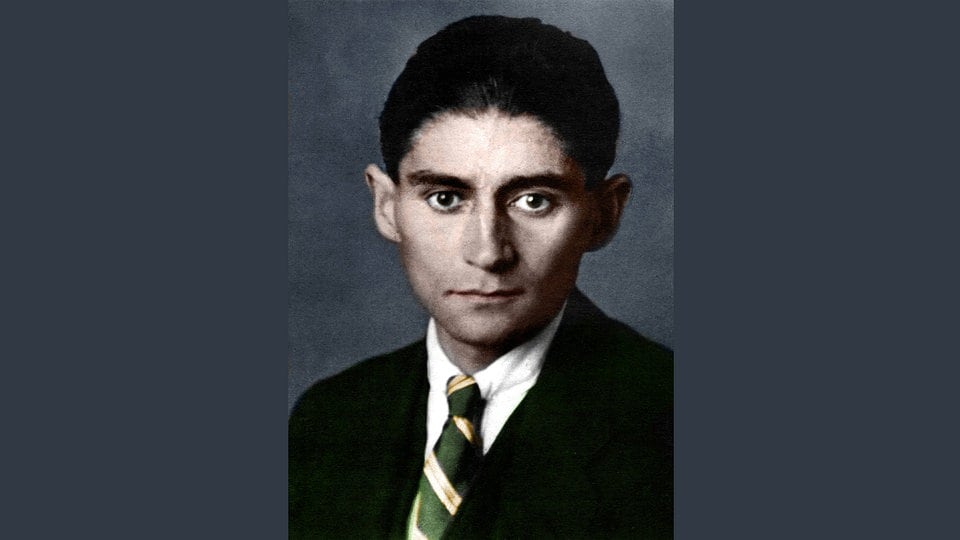- Der Schriftsteller Franz Kafka wurde 1903 durch ein Kochbuch aus Dresden zum Vegetarier, das nun neu herausgegeben wird.
- Vegetarisches Essen war für Kafka nicht nur ein Gesundheitsaspekt, sondern auch eine Waffe im Kampf gegen seine Familie.
- Die Rezepte überraschen mit kreativen Namen, Saisonalität oder Regionalität und funktionieren auch für die heutige Küche.
MDR KULTUR: Denis Scheck, Sie haben „Kafkas vegetarische Verwandlung in 544 Rezepten“ oder kurz „Kafkas Kochbuch“ herausgegeben, zusammen mit der literaturbegeisterten Ärztin Eva Gritzmann. Ein vegetarisches Kochbuch, das Kafka 1903 in die Hand gedrückt bekam und das sein Leben verändern sollte. Wie kam das Buch zu Kafka und Sie wiederum zu diesem Buch?
Denis Scheck: Das ist sozusagen unser Schliemann-Moment, unser literaturhistorisches Troja. Eva und ich haben beide in dieser dreibändigen Kafka-Biografie von Reiner Stach einen Nebensatz gelesen, der ist uns sofort ins Auge gestochen, wonach Kafka eben ein vegetarisches Kochbuch besaß. Reiner Stach ist diesem Hinweis nicht weiter nachgegangen, aber wir haben alles, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, uns in den Besitz dieses Kochbuchs aus dem 19. Jahrhundert zu setzen.
Wir haben natürlich einige uns bekannte Antiquariate angeschrieben, aber tatsächlich wurden wir sehr schnell fündig, als wir endlich den richtigen Titel und die richtige Autorin hatten. Dann hatten wir auch ganz schnell eine Auflage dieses Kochbuchs in Händen – die Auflage, die vermutlich auch Kafka besaß.
Am Ende eines jeden Aufenthaltes in Dr. Lahmanns Dresdner Sanatorium bekam jeder Gast ein Kochbuch in die Hand gedrückt mit den vegetarischen Rezepten.
Denis Scheck
Literaturkritiker
Die Autorin ist Elise Starker, die Chefköchin von Dr. Lahmanns Sanatorium auf dem Weißen Hirsch in Dresden. Das war damals ein unglaublich exklusives, elitäres Wellnessresort. Man kann das vielleicht vergleichen mit Schloss Elmau in den Alpen heute oder dem Waldhaus in Sils-Maria in der Schweiz.
Also ein mondäner Ort, ein Ort, wo die Schönen und die Reichen verkehren. Dort ging man hin, um sich zu erholen, um andere Leute kennenzulernen. Kafkas Eltern haben ihm 1903 zur Belohnung für sein bestandenes juristisches Staatsexamen einen vermutlich 14-tägigen Aufenthalt in diesem Luxusresort geschenkt.
Dort wurde ganz im Geist der Lebensreformbewegung der damaligen Zeit schon vegetarisch gekocht. Am Ende eines jeden Aufenthaltes in Dr. Lahmans Dresdner Sanatorium bekam jeder Gast ein Kochbuch in die Hand gedrückt mit den vegetarischen Rezepten.
So ist es auch mit Kafka gekommen: Der ging zurück nach Prag und drückte dort seiner Mutter dieses Kochbuch in die Hand. Die reichte es weiter – die Familie Kafka war ja schon ziemlich bürgerlich, die hatten eine Köchin – an eben diese Köchin und sagte: „Mein Sohn möchte in Zukunft so ernährt werden.“
Diese Küche von Elise Starker isst sich eigentlich so, als hätte Yotam Ottolenghi zusammen mit Jamie Oliver heute ein vegetarisches Kochbuch geschrieben.
Denis Scheck
Literaturkritiker
Kafka hat ja versucht, so ein bisschen seine Familie zu missionieren. Inwiefern war Nahrungsaufnahme Teil seiner Abarbeitung an Hermann Kafka und an seinem Opa?
Kafka entdeckte Essen als Waffe, als Waffe im Kampf, in der Auseinandersetzung mit seinem Vater Hermann. Der für uns wichtigste Fund war eine Bemerkung, die Franz Kafka seiner Freundin Milena schreibt, nämlich dass sein Großvater Schlachter war, jüdischer Fleischer.
Er schreibt Milena: „Ich muss um so viel weniger Fleisch essen, als er geschlachtet hat.“ Also Kafka hatte eine Idee von einer karmischen Gerechtigkeit. Im Grunde ist es so eine Ying-Yang-Vorstellung: Mein Großvater hat so viel Sünden auf sich geladen, und ich muss jetzt da einen Ausgleich schaffen, indem ich eben umso weniger Fleisch esse. Ich glaube, in dieser Bemerkung liegt tatsächlich ein Schlüssel zum Verständnis von Kafkas Gesamtwerk, jedenfalls seiner Biografie, insbesondere seiner Ernährungsweise.
Ich muss um so viel weniger Fleisch essen, als er geschlachtet hat.
Franz Kafka über den Fleischkonsum seines Vaters
Im Vorwort lernen wir ganz viel von dem kennen, über das wir gerade gesprochen haben. Aber kommen wir doch zu den Rezepten und zum Kochbuch. Würde man es heute als Diät-Kochbuch bezeichnen?
Ich glaube nicht, dass es ein Diät-Kochbuch ist. Wir haben natürlich vieles nachgekocht. Wir waren zunächst mal total geflasht, wie modern dieses in der ersten Auflage 1893 erschienene Kochbuch heute daherkommt. Diese Küche von Elise Starker isst sich eigentlich so, als hätte Yotam Ottolenghi zusammen mit Jamie Oliver heute ein vegetarisches Kochbuch geschrieben.
Wir haben ganz viel staunen müssen und ganz viel erkennen müssen, von dem wir uns niemals eine Vorstellung gemacht hätten. Zum Beispiel, dass Olivenöl im deutschen Kaiserreich von Wilhelm dem Zweiten doch schon so verbreitet war, dass diese Zutat gar nicht mehr großartig kommentiert und erwähnt wird.
Wir waren verblüfft, wie regional und saisonal dort gekocht wird.
Denis Scheck
Herausgeber von Kafkas Rezepten
Das ist eine sehr abwechslungsreiche Küche. Sie hat ja auch einen Jahresspeiseplan aufgestellt. Wir waren verblüfft, wie regional und saisonal dort gekocht wird. Dr. Lahmann hat ein eigenes Landgut bei Dresden betrieben, durch das er sein Sanatorium mit frischem Obst und Gemüse beliefern ließ. Elise Starker, die Chefköchin, hat sich dieser Produkte natürlich bedient und dabei Dinge gezaubert, die uns die Augen übergehen ließen.
Wir haben wenige Eingriffe in die Rezepte selbst vorgenommen. Wir haben einige Kommentare angebracht. Aber hauptsächlich haben wir eines verändert: Das Wort „Soße“ ist für Elise Starke ein schreckliches Fremdwort, das sie durch Beiguss ersetzt. Uns hingegen im 21. Jahrhundert klingt der Beiguss unglaublich altertümlich in den Ohren. Deshalb haben wir den Beiguss wieder durch Soße ersetzt und flux liest sich dieses Kochbuch eigentlich so, als wäre es fast heute entstanden.
Eines der ersten Rezepte ist eine Baumwollsuppe. Da wird natürlich nicht Baumwolle gekocht, sondern so eine Eiermischung in Wasser gerührt, so dass es nachher wie Wolle aussieht. Es gibt noch andere kreative Namen für Gerichte, und ich vermute, das hat Ihnen als Literaturkritiker und Literat auch sehr gefallen.
Da ging mir natürlich das Herz auf. Wer hätte nicht gerne solche Gerichte auf dem Teller wie ein „Herz im Schnee“ oder eine Sauerampfersuppe, gefüllter Sellerie, gebackener Pastinaken-Spargelpudding. Es gibt unglaublich poetische Formulierungen, die man heute kaum mehr kennt.
Eine ganz wunderbare Eigenart dieses Kochbuchs sind ja die vielen Gemüsepuddings. Sie macht Pudding aus Spargel, sie macht Pudding aus Spinat, sie kocht mit wunderbaren Salaten, beispielsweise ein „Kingsford“- Salat, den wir zu recherchieren versuchten. Sie hat wunderbare Nachspeisen, armer Ritter ist natürlich vertreten, der Ofenschlupfer, einen neuen Lotpudding, Morchelpastetchen – überhaupt, Pilze spielen eine große Rolle.
Ich prophezeie der Kölner Schnitte eine große Zukunft.
Denis Scheck
Journalist und Wahlkölner
Die größte Entdeckung für mich als Wahlkölner war natürlich die Kölner Schnitte, von der ich noch nie gehört hatte, die sich als überaus schmackhafte Gemüsefrikadelle herausstellt, die man mit einem Mehl zubereitet, das heißt Gofio. Das ist eigentlich eine Spezialität der Kanarischen Inseln. Die rösten dort ihr Getreide, bevor sie es zu Mehl verarbeiten, also Gerste oder Weizen oder Mais. Und dieses Gofiomehl hat dadurch einen sehr nussigen Beigeschmack. Als ich zum ersten Mal diese Kölner Schnitte nachkochte, hätte ich fast gewettet, dass in dieser Bulette, in dieser Frikadelle, Fleisch enthalten ist, so überzeugend schmeckt sie. Ich prophezeie der Kölner Schnitte eine große Zukunft.