Wuppertal. Die Genossenschaft versorgte einst 40 Prozent der Wuppertaler Arbeiterfamilien mit Lebensmitteln. Heute erzählt sie 125 Jahre Wuppertaler Stadtgeschichte.
Der Aufzug ist das Detail, das Stefan Kühn besonders am Herzen liegt. Als die Konsumgenossenschaft Vorwärts 1904 ihr neues Gebäude in Barmen bezog, ließen die Arbeiter einen Lastenaufzug einbauen, der die schweren Mehlsäcke in die oberste Etage transportierte. „Damals wurde das eigentlich durch Muskelkraft erledigt“, erklärt Kühn, Vorstand des Fördervereins. „Aber hier legte man von Anfang an Wert auf Arbeitsschutz und Arbeitnehmerfreundlichkeit.“
Es ist ein kleines Detail, das viel über den Geist dieser besonderen Genossenschaft verrät. Was 1899 als Zusammenschluss von 40 Gewerkschaftern begann, entwickelte sich binnen weniger Jahre zu einem der erfolgreichsten genossenschaftlichen Unternehmen im Deutschen Reich. Bis zu einer Million Brote wurden hier pro Jahr gebacken, 40 Prozent aller Menschen in Barmen und Umgebung mit Lebensmitteln versorgt.


Eine Million Brote pro Jahr: So erfolgreich war die Genossenschaft in Barmen
Die Idee war simpel: Gemeinsam einkaufen, um bessere Qualität für weniger Geld zu bekommen. „Die Lebenswirklichkeit damals war geprägt durch Armut, durch Hunger, durch Krankheit, Wohnungsnot“, erklärt Stefan Kühn. „So kam man auf die Idee: Wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir gemeinschaftlich einkaufen, wird es für uns billiger.“
Doch dabei blieb es nicht. Schnell entstand die Idee, nicht nur gemeinsam einzukaufen, sondern auch gemeinschaftlich zu produzieren. Die große Bäckerei sollte die Arbeiterinnen und Arbeiter mit dem wichtigsten Grundnahrungsmittel versorgen – und das so erfolgreich, dass die Brote bis nach Ronsdorf, in den Ennepe-Ruhr-Kreis und sogar bis Hagen geliefert wurden.
Konsumgenossenschaft Vorwärts in Barmen
Das Erfolgsrezept war durchdacht: Wer sein Brot über die Genossenschaft kaufen wollte, musste Mitglied werden. Ende des Jahres wurden alle Mitglieder an den Gewinnen beteiligt, die direkt in der genossenschaftlich organisierten Bank gutgeschrieben werden konnten. So entstand ein Kreislauf, der es den Arbeitern ermöglichte, einen Notgroschen für harte Zeiten anzusparen.
In zehn Jahren versorgte die Konsumgenossenschaft 40.000 Mitglieder
Der Erfolg war überwältigend. „In den ersten Jahren wurden jedes Jahr 1000 neue Mitglieder aufgenommen, wobei hinter jedem Mitglied eine ganze Familie stand“, berichtet Kühn. Nach nur zehn Jahren wurden bereits 40.000 Menschen versorgt. Anfang der 1930er-Jahre waren 40 Prozent aller Menschen in Barmen und dem benachbarten Elberfeld Mitglied einer Konsumgenossenschaft.
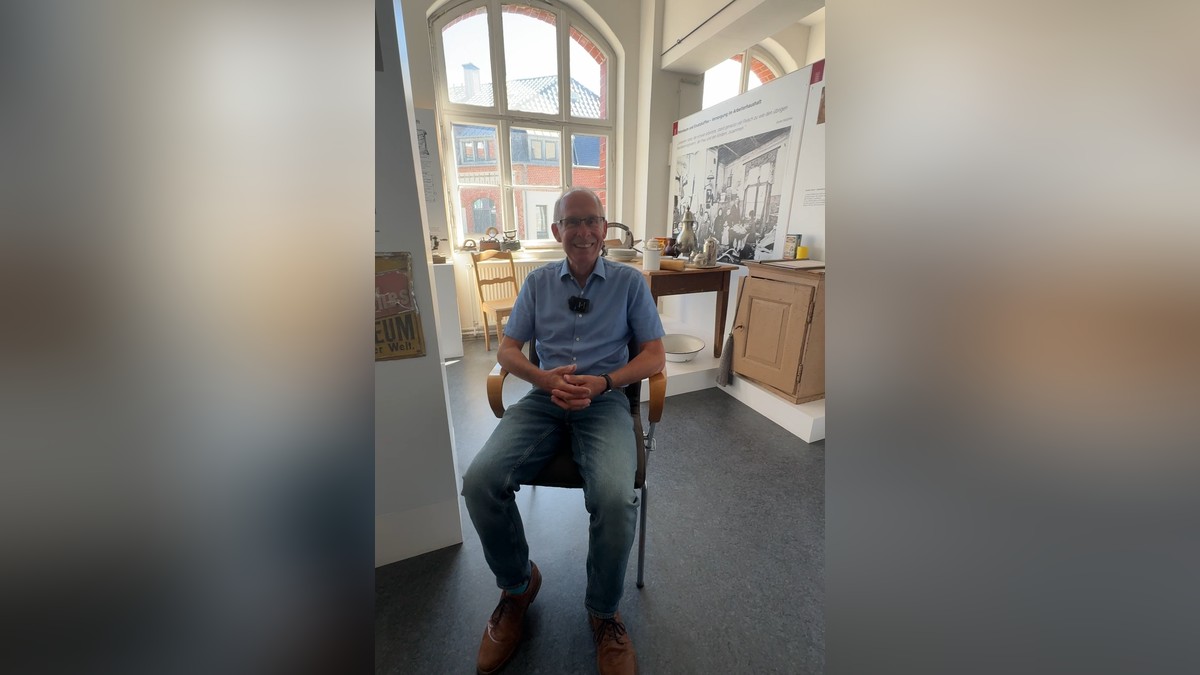
Der Vorsitzendes des Fördervereins der ehemaligen Konsumgenossenschaft Vorwärts, Stefan Kühn.
© Benedikt Dahlmann
1924 entschieden die Genossenschaften aus Barmen und Elberfeld, sich zusammenzuschließen. Es entstand das damals größte Gebäude einer Konsumgenossenschaft im gesamten Deutschen Reich.
Chronik der Konsumgenossenschaft Vorwärts
1899: Gründung der Konsumgenossenschaft Vorwärts durch 40 Arbeiter
1904: Bau des Gebäudekomplexes in Barmen
1924: Zusammenschluss der Genossenschaften Barmen und Elberfeld, Bau des größten Genossenschaftsgebäudes im Deutschen Reich
1933: Auflösung der Genossenschaft durch das NS-Regime
1933-1936: Nutzung als Gefangenenlager und Folterkammer
1936-1943: Wehrmachtskaserne
1943-1953: Lebensmittelgroßhandel
1953-1961: Erste Nutzung als Flüchtlingsunterkunft
1991-1998: Flüchtlingsunterkunft während der post-jugoslawischen Kriege
2015-2018: Flüchtlingsunterkunft für syrische Geflüchtete
Doch der Erfolg weckte auch Widerstand. „Einerseits gab es eine ganz große Begeisterung der arbeitenden Menschen“, erklärt Kühn, „aber das stieß auf Widerstand der Unternehmer und auch des Staates.“
Denn hinter der praktischen Idee steckte eine politische Vision: Die Genossenschaftsbewegung sah ihr Modell als Instrument, den Kapitalismus zu überwinden. Ein Dorn im Auge der herrschenden Klasse. Doch wegen ihrer sozialen Funktion wurde die Genossenschaft geduldet.
Von der Folterkammer zur Flüchtlingsunterkunft
Bis 1933. Die Nationalsozialisten zerschlugen die Genossenschaften, weil sie den Prinzipien ihrer Ideologie widersprach. „Genossenschaftler wurden verhaftet, gefoltert und ermordet“, sagt Kühn. Das Gebäude selbst wurde von 1933 bis 1936 als Gefangenenlager und Folterkammer missbraucht, danach bis 1943 als Wehrmachtskaserne genutzt.
Nach dem Krieg begann ein neues Kapitel. Bis 1953 diente das Gebäude als Lebensmittelgroßhandel, später wurde es zur Flüchtlingsunterkunft. Gleich drei Mal erfüllte es diese Funktion: von 1953 bis 1961, während der post-jugoslawischen Kriege von 1991 bis 1998 und von 2015 bis 2018 für Geflüchtete aus Syrien.
„Nicht nur deswegen ist es seit 1899 ein Ort der Stadtgeschichte, der Sozialgeschichte, der Wirtschafts- und der politischen Geschichte“, fasst Stefan Kühn zusammen. „Ein einzigartiger Ort.“ Heute zeigt der Förderverein in dem historischen Gebäudekomplex eine Dauerausstellung, damit diese Geschichte nicht vergessen wird.
Weitere Themen aus Wuppertal
