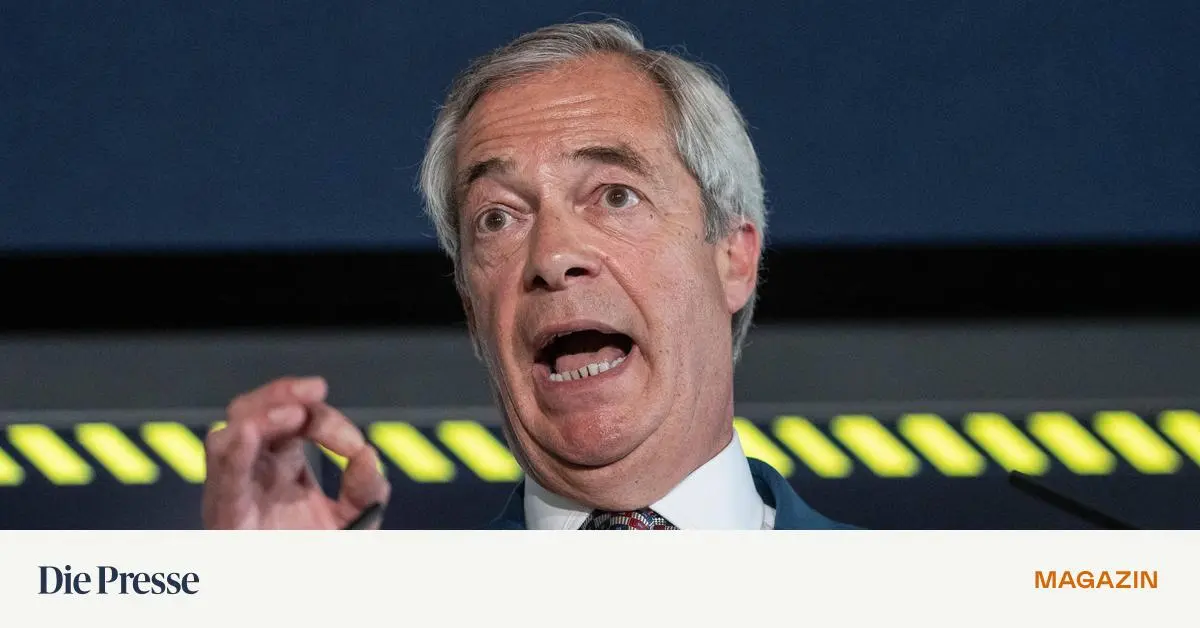Die Debatte über „Scharia-Gerichte“ in Großbritannien flammt immer wieder auf. Vor zehn Jahren behauptete Nigel Farage, heute Chef der Rechtspartei Reform UK, dass es muslimische „Ghettos“ gebe, die gemäß Scharia-Gesetzen regiert würden. Ähnlich beunruhigend war die Schlagzeile, die im Dezember die Runde machte: Großbritannien sei die „Hauptstadt der Scharia-Gerichte“, berichteten Medien.
Diese Institutionen würden Polygamie normalisieren und dafür sorgen, dass Frauen nur halb so viel erben wie Männer, hieß es. Die Gerichte seien auch „zunehmend einflussreich“: Aus Kontinentaleuropa und den USA würden Muslime nach Großbritannien reisen, um ihre Dienste in Anspruch zu nehmen.
Bei näherem Hinsehen erscheint die Situation deutlich weniger dramatisch. Sogenannte Scharia-Räte gibt es in Großbritannien seit den frühen 1980er-Jahren. Sie befassen sich vornehmlich mit familiären Angelegenheiten, in erster Linie mit Scheidungen nach islamischem Recht – deshalb werden sie auch als „Islamic divorce services“ bezeichnet.
Heirat ohne Standesamt
Viele muslimische Paare registrieren ihre Heirat nicht beim Standesamt, sondern beschränken sich auf eine religiöse Zeremonie. Das bedeutet aber auch, dass ihnen die rechtliche Scheidung verwehrt bleibt – stattdessen müssen sie sich an einen Scharia-Rat wenden, damit die Trennung vollzogen werden kann. Entscheidend ist, dass Scharia-Räte keinen rechtlichen Status haben: Sie sind keine Gerichte, stellen kein paralleles Rechtssystem dar und können Entscheide englischer Gerichte nicht aufheben. Polygamie etwa ist nach britischem Recht verboten, also darf sie auch von Scharia-Räten nicht bewilligt werden.
Die Councils beschäftigen sich ausschließlich mit religiösen Fragen. Wie viele solche Räte in Großbritannien existieren, darüber gibt es keine verlässlichen Statistiken; Schätzungen reichen von 30 bis 80.
Frauen benachteiligt
2016 gab die damalige Innenministerin, Theresa May, eine unabhängige Untersuchung in Auftrag, um festzustellen, wie Scharia-Recht in England angewandt wird und ob es missbraucht wird. Die Autoren des 2018 veröffentlichten Berichts halten fest, dass rund 90% der Menschen, die sich an einen Scharia-Rat wenden, Frauen sind, die eine islamische Scheidung beantragen. Der Grund ist, dass sich Ehemänner nach islamischem Recht problemlos unilateral scheiden lassen können, während diese Option Frauen verwehrt bleibt.
Laut dem Untersuchungsbericht gibt es an der Arbeit vieler Scharia-Räte wenig auszusetzen, aber es werden auch Probleme genannt: Manche Frauen werden auf unangemessene Weise befragt, andere gedrängt, ihrem Ehemann bei Scheidungen Zugeständnisse zu machen, etwa finanzielle. Auch gebe es unter den Ratsmitgliedern sehr wenige Frauen. Die Autoren empfehlen Reformen. So soll sichergestellt werden, dass parallel zur religiösen Heirat stets eine Ziviltrauung stattfindet, um die Eheschließung rechtlich zu verankern. Zudem brauche es Aufklärung: Muslimische Communitys müssen Frauenrechte, die im Zivilrecht festgeschrieben sind, anerkennen, besonders in Fragen von Heirat und Scheidung.
Aufklärungskampagnen nötig
Dazu brauche es Bildungsprogramme und Aufklärungskampagnen, damit Frauen über ihre Rechte Bescheid wissen. So soll nach und nach dafür gesorgt werden, dass Scharia-Räte am Ende gar nicht mehr nötig sind.
Ähnlich äußerte sich auch Shaista Gohir, eine Frauenrechtlerin und Mitglied im britischen Oberhaus, die dem Muslim Women’s Network UK vorsteht. „Viele Frauen erzählen uns, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen, besonders wenn es um häusliche Gewalt geht“, sagte Gohir vor einigen Monaten in einem Radiointerview.
Fortschritte seit 2015
Allerdings habe es in den vergangenen zehn Jahren Fortschritte gegeben. Viele der Scharia-Räte haben einen Verhaltenskodex eingeführt, es gebe mehr Informationen über die Zusammensetzung der Räte, sagte Gohir.
„Aber es gibt noch immer viel Arbeit zu tun“, fügte Gohir hinzu. Dass Großbritannien jedoch die „Hauptstadt der Scharia-Gerichte“ geworden sei und „muslimische Ghettos“ dulde, dafür gebe es keine Hinweise.