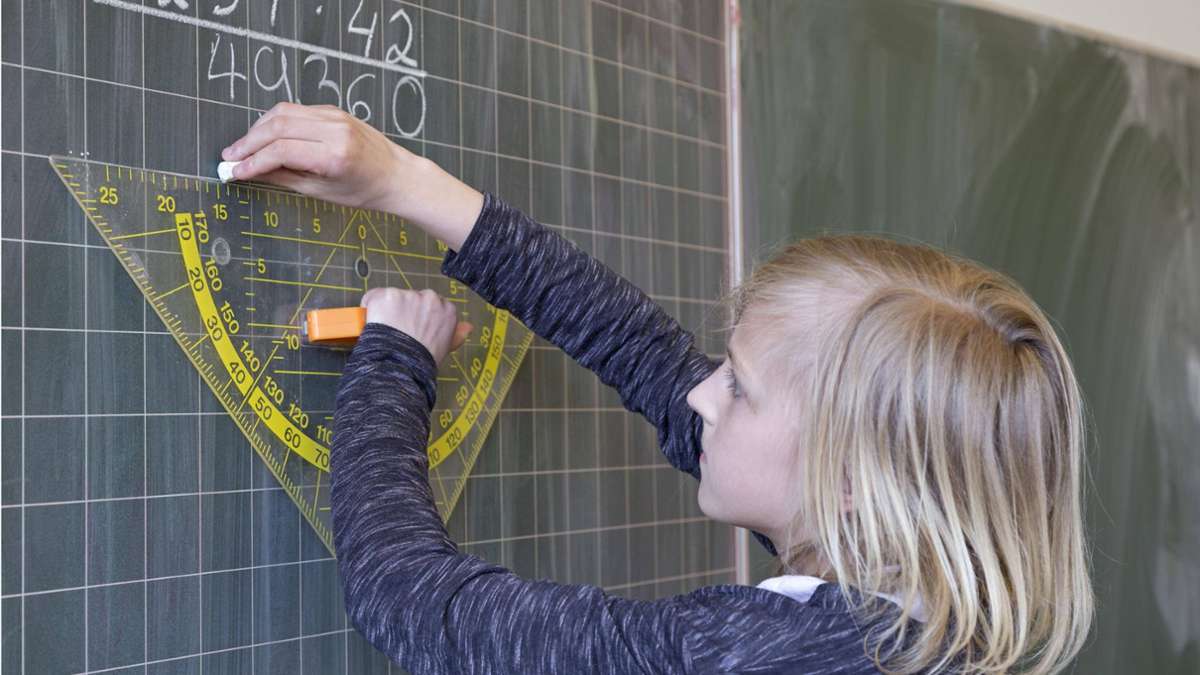Eine Schule für Jungen, eine Schule für Mädchen: bis in die 1960er Jahre hinein war das in Deutschland weit verbreitet. „Heute dagegen klingt es wahlweise altmodisch oder elitär, wenn man auf eine monoedukative Schule geht“, sagt Wiebke Waburg, Professorin für Pädagogik an der Universität Koblenz. Denn es gibt nur noch etwa 130 reine Mädchenschulen und fünf reine Jungenschulen in Deutschland – gegenüber den mehr als 36 000 koedukativen Schulen bilden sie damit die absoluten Ausnahmen. Der Großteil dieser Schulen ist in Süddeutschland, viele sind privat und konfessionell geführt und meist in katholischer Trägerschaft.
So wie beispielsweise das Mädchengymnasium St. Agnes in Stuttgart, das bereits im Jahr 1886 gegründet wurde und heute etwa 1000 Schülerinnen besuchen. Eine davon ist Anna Faigle, 17 Jahre alt. Schon im Kindergarten hat ihr eine Freundin davon erzählt, dass es eine Schule nur für Mädchen gibt. „Von da an war mir klar, da will ich hin. Ich habe zwei Brüder, vielleicht war für mich deshalb die Vorstellung so schön, mal nur unter Mädchen zu sein“, erzählt Anna Faigle.
 Anna Faigle Foto: privat
Anna Faigle Foto: privat
Und tatsächlich habe sie dort genau die Gemeinschaft gefunden, die sie sich immer gewünscht habe. „Insbesondere während der Pubertät merkt man einfach, dass wir Mädels alle die gleichen Dinge durchmachen und uns darüber gut austauschen können“, sagt Anna Faigle. Auch Helene Wagner, 11 Jahre, die gerade ihr erstes Jahr am St. Agnes hinter sich hat, freut sich über diesen Austausch und erzählt von einem Projekt über körperliche Veränderungen bei Mädchen.
 Helene Wagner Foto: privat
Helene Wagner Foto: privat
Helene Wagner erinnert sich noch gut an ihre Grundschulzeit in einer gemischten Klasse. „Der Unterricht war oft lebhaft und lauter, was manchmal etwas ablenkend sein konnte. Jetzt fällt es mir leichter, mich zu konzentrieren.“
 Viktoria Schoenrade Foto: privat
Viktoria Schoenrade Foto: privat
Ähnlich geht es auch ihrer Freundin Viktoria Schoenrade, bei der schon Großmutter, Mutter und Patentante im St. Agnes waren. „Sie haben mir so viele schöne Dinge über die Schule erzählt. Und ich habe auch schon gute Freundinnen gefunden hier.“
Da es nur noch so wenige monoedukative Schulen in Deutschland gibt, fehlt es auch an aktueller Forschung dazu, welche Vor- oder Nachteile die Geschlechtertrennung heute tatsächlich noch mit sich bringt.
Als Wiebke Waburg vor mehr als 20 Jahren eine große Studie zum Thema betreut hat, bei der auch viele Schülerinnen befragt wurden, war in sozialer Hinsicht auch die Annahme, unter Mädchen gebe es viel „Zickenkrieg“, ein Thema. Oder auch die Tatsache, dass Jungen manche Sozialkompetenzen vielleicht besser lernen, wenn sie mit Mädchen in einer Klasse sitzen, denen diese Talente eher zugeschrieben werden. Und gerade während der Pubertät wurde das Fehlen von Jungs von den Mädchen nicht nur als positiv bewertet. Es gab auch die Sorge, ob der Umgang mit dem anderen Geschlecht trotz der Trennung eingeübt werden könnte.
Studie: Vorteile für Mädchen in Physik
Anna Faigle sieht das pragmatisch. „Ich verbringe ja nicht meine ganze Zeit an der Schule. Ich habe einen gemischten Freundeskreis, bin in der Jugendarbeit aktiv. Und da finde ich es dann auch schön, wenn Jungs dabei sind.“ Auch Wiebke Waburg gibt zu bedenken, dass Mädchen und Jungen auch an gemischten Schulen häufig stark getrennte Gruppen bilden, die zwar in einem Klassenzimmer sitzen – darüber hinaus aber oft weniger Austausch hätten, als Eltern das so vermuten würden.
Wo Wiebke Warburg damals eindeutige Vorteile für Mädchenschulen feststellen konnte, war der Physikunterricht. „In diesem Fach haben sich die Mädchen wohler gefühlt, wenn sie nur unter sich waren. Sie hatten größeres Interesse daran und auch bessere Noten.“ Zudem mussten sie die Experimente selbst durchführen, statt diese den Jungs zu überlassen und nur die Protokolle zu schreiben – wie es im koedukativen Unterricht oft der Fall ist. In anderen Fächern dagegen seien die Unterschiede nicht nennenswert gewesen. Eine Sonderrolle spielt dabei der Sportunterricht, der nicht untersucht wurde, weil er ab der weiterführenden Schule ohnehin meist nach Geschlechtern getrennt unterrichtet wird.
Eine oft gehörte Sorge von Eltern in Bezug auf Monoedukation kann die Pädagogin entkräften: dass dort klassische Rollenbilder eher verfestigt würden. „Es ist vielmehr sogar so, dass Mädchen und Jungen sich tatsächlich differenzierter verhalten, wenn sie in gleichgeschlechtlichen Gruppen unterrichtet werden“, sagt Wiebke Waburg. Letztlich sieht sie aber all diese Vor- oder Nachteile nicht als ausschlaggebend dafür, dass sich Eltern oder Kinder für eine monoedukative Schule entscheiden. „Oft ist es ja vielmehr der Ruf der Schule oder das gesamte Konzept oder die regionale Nähe, was den Ausschlag gibt“, sagt Wiebke Waburg.
Vater: Mehr Bewegung kommt Jungen entgegen
So sieht es auch Marcus Schafft, Elternbeiratsvorsitzender der Franz-von-Sales-Schule. Sie ist eine katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart und hat in Obermarchtal einen Standort nur für Mädchen. In Ehingen gibt es eine der wenigen reinen Jungenrealschulen in Deutschland. „Wir haben uns dazu entschieden, unseren Sohn auf diese Schule zu geben, weil sie sehr klein ist und sich alle 160 Schüler mit Namen kennen“, sagt Marcus Schafft.
Auch das Lernkonzept, das eine klare Struktur mit vielfältigen Pausen und Bewegung vorsieht, habe ihn überzeugt. „Das kommt gerade Jungs beim Wechsel auf die weiterführende Schule entgegen, weil sie oft noch mehr Zeit und auch Bewegung brauchen, um in den Lernrhythmus zu finden“, findet er.
In seiner Freizeit habe der Sohn einen gemischten Freundeskreis, der über die Schule hinausgehe – und auch eine Freundin. „Ich habe nicht den Eindruck, dass er da durch die Schulwahl irgendwelche Nachteile oder Probleme hätte“, sagt Marcus Schafft.
 Philipp Hagel Foto: privat
Philipp Hagel Foto: privat
Philipp Hagel ist 14 Jahre alt, Schüler der Franz-von-Sales-Schule und spielt in seiner Freizeit am liebsten Fußball. Dass er auch während der Schulzeit immer wieder Zeit zum Kicken hat und sich die vielen Sportstunden oder auch Ausflüge an den Bedürfnissen der Jungs ausrichten, findet er gut. „Außerdem sind wir eine Ganztagesschule. Ich habe keine Hausaufgaben mehr, wenn ich nach Hause komme, auch das gefällt mir.“
Im Vergleich zu seiner Grundschulzeit in einer gemischten Klasse sei es schon manchmal lauter oder wilder, wenn nur Jungs in einer Klasse säßen. „Aber daran habe ich mich gewöhnt und könnte mir keine andere Schule mehr vorstellen“, erzählt sagt Philipp Hagel.
Expertin: In Deutschland werden monoedukative Schulen aussterben
Seit Wiebke Waburg vor über 20 Jahren ihre Studie zu den monoedukativen Schulen in Deutschland durchgeführt hat, ist deren Zahl stetig gesunken. Über die Gründe kann sie nur mutmaßen. „Viele dieser Schulen sind ja in katholischer Trägerschaft, dahinter muss man als Eltern stehen. Und auch Lehrkräfte, die an solchen Schulen unterrichten, müssen das Konzept gut finden“, sagt Wiebke Waburg.
Die Pädagogik-Professorin geht davon aus, dass es hierzulande irgendwann keine monoedukativen Schulen mehr gibt. „Andererseits werden sie in Tansania gerade erst eingeführt und dort als großer Fortschritt betrachtet. Hier findet man, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen von Jungen und Mädchen besser Rechenschaft tragen.“
Mädchen und Schulbildung
Vor 100 Jahren
gingen Jungen und Mädchen nur gemeinsam zur Grundschule. Danach gab es deshalb spezielle Schulen für Mädchen, weil der Schwerpunkt ihrer Ausbildung auf Hauswirtschaft, Handarbeit und Religion lag und sie meist nicht so lange wie Jungen eine Schule besuchten, sondern Dienstmädchen wurden oder eine eigene Familie gründeten.
Im Jahr 1908
wurde dann eine Bildungsreform verabschiedet, mit der Mädchenbildung gefördert werden sollte. Ab da gab es auch Gymnasien für Mädchen, die auch auf ein Universitätsstudium vorbereiten sollten, trotzdem aber lange Zeit weiterhin den Schwerpunkt auf häuslichen Tätigkeiten hatten. Erst mit der Bildungsreform nach 1968 wird das Mädchengymnasium zum Auslaufmodell.