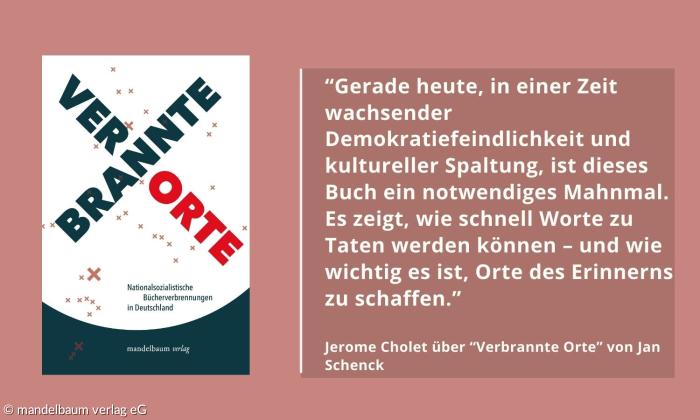An über 100 Orten in Deutschland wurden zwischen 1933 und 1934 Bücher verbrannt. Jan Schenck hat ein eindringliches Erinnerungsprojekt begonnen, das die Orte heute zeigt und die mangelnde Sichtbarkeit dokumentiert. In diesem Bildband präsentiert er die Schauplätze der Verbrennungen heute, flankiert durch ein umfassenderes Projekt mit einer umfassenden Deutschlandkarte.
Bebelplatz, Berlin 10. Mai 1933. Hier in der Nähe der Staatsoper Unter den Linden und der Humboldt-Universität verbrannte die Deutsche Studentenschaft mehr als 20.000 Bücher. Eingeleitet durch einen Fackelzug von 5.000 Student*innen, begleitet von einer Rede des Propagandaministers Joseph Göbbels wurden Werke von Autoren wie Erich Kästner, Sigmund Freud, Karl Marx, Heinrich Heine und Bertolt Brecht „den Flammen übergeben“.
Es folgten 12 Jahre nationalsozialistischer Diktatur, Krieg, Holocaust. Millionen Menschen wurden umgebracht.
Vieles Unbekannt
Viele kennen die Bilder und die Tonaufnahmen von dem traurigen Ereignis in Berlin. Doch die Bücherverbrennungen waren kein spontanes Ereignis, sondern Teil eines langfristig vorbereiteten Prozesses, bereits Wochen zuvor fanden in Universitätsstädten wie München, Heidelberg oder Göttingen ähnliche Aktionen statt.
Und Joseph Goebbels war nicht der zentrale Akteur, wie oft angenommen. Vielmehr waren es lokale NSDAP-Gruppen, studentische Organisationen wie die Deutsche Studentenschaft, Bibliothekar*innen, Lehrer*innen und sogar Bürgermeister*innen, und kirchliche Organisationen, die die Verbrennungen an mehr als 160 Orten organisierten und durchführten.
Leider sind die viele Orte der Bücherverbrennungen heute oft unsichtbar. Nur wenige Plätze tragen Gedenktafeln oder Hinweise. Viele sind belebte Plätze, Uni-Campusse oder Parks – ohne ein Zeichen dessen, was dort 1933 geschah.
Deshalb ist Jan Schencks Fotoband eine wertvolle Bereicherung, der Herausgeber hat Fotografie studiert und arbeitet als Erlebnispädagoge. Er gründete 2013 das Gedenkprojekt „Verbrannte Orte“ und koordiniert den heutigen Trägerverein. Sein Fotoband kombiniert historische Recherche mit eindrucksvollen Fotografien der heutigen Orte, ergänzt durch eine digitalen Karte im Internet.
In seinem Buch kommen Historiker*innen, Bibliothekswissenschaftler*innen, Germanistiker*innen und andere Experti*innen zu Wort und liefern überraschende Einsichten, eindrucksvolle Informationen und Einblicke in die Biographien der betroffenen Autor*innen.
Ein Beitrag in kritischen Zeiten
Gerade heute, in einer Zeit wachsender Demokratiefeindlichkeit und kultureller Spaltung, ist dieses Buch ein notwendiges Mahnmal. Es zeigt, wie schnell Worte zu Taten werden können – und wie wichtig es ist, Orte des Erinnerns zu schaffen. Denn wie Heinrich Heine bereits 1821 schrieb: „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“
„Verbrannte Orte“ ist ein herausragendes Werk – historisch fundiert, visuell eindrucksvoll und gesellschaftlich hochrelevant. Es verdient breite Aufmerksamkeit, in Schulen, Universitäten und öffentlichen Räumen. Und es braucht mehr als nur Leser*innen: Es braucht Städte, die sich erinnern; Tafeln, Mahnmale, Gespräche.
Zur interaktiven Deutschlandkarte der verbrannten Orte
Jan Schenck (2023): Verbrannte Orte. Nationalsozialistische Bücherverbrennungen in Deutschland, mandelbaum verlag, 192 Seiten, 25 Euro.
Hier im sozialen Buchhandel Buch7 bestellen