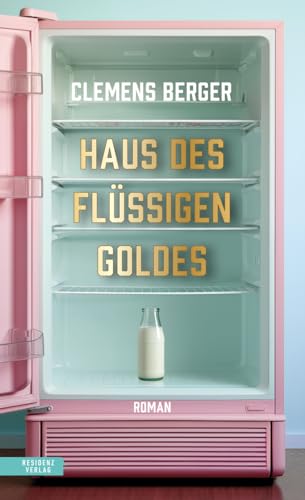In dem Roman „Haus des flüssigen Goldes“ stellt Christian Berger die Frage nach der Bedeutung von Muttermilch
Von Miriam Seidler![]()
![]()
Besprochene Bücher / Literaturhinweise
Während der Corona-Pandemie wurde das Toilettenpapier knapp, da in den privaten Haushalten wesentlich mehr verbraucht wurde, als das in normalen Zeiten der Fall ist. Der Lieferengpass weckte zumindest kurzfristig das Bewusstsein dafür, dass wir in unserem Alltag von Firmen und deren Logistik abhängig sind. Was, so fragt Christian Berger in seinem Roman Haus des flüssigen Goldes wenn nicht das Toilettenpapier ausgeht, sondern ein Grundnahrungsmittel für eine Bevölkerungsgruppe, die wie keine andere aufgrund ihrer Hilflosigkeit auf Unterstützung angewiesen ist? Was, wenn kein Milchpulver für Babynahrung verfügbar ist?
Das ist der Ausgangspunkt des satirischen, aber in seiner kritischen Reflexion durchaus ernst zu nehmenden Romans Haus des flüssigen Goldes. In einem Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft gibt es aufgrund einer Verunreinigung der Anlagen beim größten Hersteller von Babynahrung einen Lieferengpass. Die Regale sind leer. Mütter, die nicht stillen können oder wollen, sind verzweifelt. Ihre Babys hungern. Da richten sich alle Augen in den sozialen Medien auf ein Geschäftsmodell, für das sich bislang wenige interessiert haben: Im Haus des flüssigen Goldes pumpen junge Frauen ihre Muttermilch ab, die zu horrenden Preisen verkauft wird. Reiche Paare decken sich hier mit zertifizierter Muttermilch ein und sorgen somit für einen guten Start für ihren Nachwuchs ins Leben. Aber auch Bodybuilder glauben daran, dass Muttermilch sie beim Muskelaufbau unterstützt und kaufen diese zu hohen Preisen ein. Die modernen Ammen verdienen gut. Clarissa, die Erfinderin dieses Erfolgsmodells, bietet ihnen und ihrem Nachwuchs ein Rundum-Sorglos-Paket: Ernährung, Fitnessprogramm und Kinderbetreuung werden im Haus des flüssigen Goldes ebenso zur Verfügung gestellt, wie eigene Räume, in denen die Frauen sich einrichten können, um ihre Milch abzupumpen.
Doch mit dem Engpass in der Lieferung von Milchpulver nimmt die Kritik zu. Vor dem Haus demonstrieren aufgebrachte Menschen, die sich um die Ernährung ihrer Kinder sorgen, weil hier Milch nicht kostenfrei abgegeben wird. In Zeiten der Not, so ihre Argumentation, muss die Gesellschaft zusammenhalten. Der Appell an die Mütter wird kontrovers diskutiert. In ihrem Selbstverständnis sind die jungen Mütter Unternehmerinnen und es bleibt ihnen – ähnlich wie einem Sportler, der ebenso das Potential seines Körpers nutzt – nur wenig Zeit, um mit ihrer Muttermilch Geld zu verdienen und sich somit ein Polster für später anzulegen. Als Gegenmodell wird die liebende Mutter aufgerufen, die sich und ihre Milch selbstlos weitergibt.
Der Roman beginnt mit einer Aufsehen erregenden Geste: Die junge Mutter Maya kommt mit ihrer Tochter am Haus des flüssigen Goldes an. Ihr Job gibt ihr Selbstbewusstsein und so nimmt sie nicht den Hintereingang, sondern schreitet mit ihrer Tochter durch die demonstrierende Menge. Kurzbevor sie das Haus erreicht, werden die Rufe lauter. Sie richten sich nicht an Maya, sondern an ihre Tochter: „Deine Mutter ist eine Schande für alle Mütter.“ Ganz abgesehen davon, dass hier ein Anspruch formuliert wird, der der Frau das Recht entzieht, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, wehrt sich Maya nun, indem sie der Menge mit einer Geste ihre Meinung kundtut, die wenig später viral geht:
Da stand ich, Maya, im schwarzen Trainingsanzug, mit knallgelben Turnschuhen, eine Sonnenbrille im Gesicht, mit meiner Tochter, deren Gesicht man zum Glück nicht sehen konnte, auf dem Arm, vor dem Eingang zum Haus des flüssigen Goldes, hinter mir zwei grimmige Sicherheitsmänner, neben meinem rechten Turnschuh eine große Kühlbox – und streckte formvollendet meinen Mittelfinger in die Luft. Ich sah weder verärgert noch wütend aus. Ich hatte ein leises Lächeln um die Mundwinkel.
Mayas Instagram Account wird in den nächsten Stunden vor allem mit Hassbotschaften geflutet. Ihre Adresse kursiert im Netz und sie muss im gut gesicherten Haus des flüssigen Goldes bleiben. Am nächsten Tag nehmen auch hier die Proteste zu und Maya gerät wieder ins Rampenlicht. Als eine Mutter ihr hungriges Kind vor dem Haus ablegt, geht sie hinaus und stillt das schreiende Kind vor den Augen der Öffentlichkeit. Der Impuls, dem Kind zu helfen, wird ihr nun im Haus des flüssigen Goldes als Verstoß gegen ihren Vertrag ausgelegt:
Ich, die siebzig Liter der nahrhaftesten Muttermilch pro Woche abpumpte, ich, die mit Abstand die besten Werte hatte, mich gesund ernährte, sportlich und fit war, […] ich, Maya, die einem hilflosen Geschöpf wieder Kraft eingeflößt hatte, ich, die pumpte und pumpte, abfüllte und abfüllte, Kühlschränke und Eisschränke voller Milchfläschchen und Milchpackungen, ich, die gab und gab und sich keinen Augenblick beklagt hatte, ich, die erstmals kurz davor war, Goldene des Monats zu werden – ich, Maya, sollte gestohlen haben?!
Von uns? Von einem Wir, in dem ich schon nicht mehr enthalten war? Von einem Wir, an dem ich beharrlich gearbeitet hatte, wenn es böses Blut zwischen den Goldenen gegeben, wenn sich eine zurückgesetzt, übersehen gefühlt hatte? […]
Unser Vertrag sagte, dass außer der Milch, die für mein Kind war, alle Milch, die ich produzierte, dem Haus des flüssigen Goldes gehörte. In diesem Moment war dieses Kind mein Kind gewesen. Unser Kind. Unser aller Kind, von denen drinnen und denen draußen. Ich war maßlos enttäuscht von Clarissa. Wir, Mia und ich, waren maßlos enttäuscht von ihr.
Mayas Selbstbild changiert hier zwischen der hingebungsvollen Frau und Mutter, die ihren Körper ausbeutet, um anderen zu helfen. Andererseits ist sie auch alleinerziehende Mutter, die um jeden Preis für sich und ihre Tochter sorgen muss und das angenehme Leben, das sie im Haus des flüssigen Goldes lebt, nicht aufgeben möchte. Ihre Wehklage hilft ihr nicht: Sie muss das Haus mit ihrer kleinen Tochter verlassen und Clemens Berger legt schonungslos die Widersprüchlichkeit im Handeln seiner Figur offen.
Die junge Mutter wird mit ihrem Kind im Folgenden von einem zum anderen gereicht. Alle wollen ihr helfen – wobei es vor allem darum geht, aus der Situation finanziellen Gewinn zu schlagen. Sei es der Fußballprofi, der sie als Amme für seine Kinder gewinnen will, oder die Influencerin, die mit dem gemeinsamen Auftritt für Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken sorgt, oder der Konzern, der mit ihr Werbung für sein Milchpulver machen möchte – jeder verfolgt seine eigenen Ziele und Maya muss sich darüber klar werden, wie sie sich positionieren will. Wobei für sie auch die Frage im Fokus steht, wie sie die Lage gewinnbringend für sich und ihre Tochter nutzen kann.
Christian Berger hat mit dem rasant erzählten Buch Haus des flüssigen Goldes einen Roman über ein Leben in Zeiten von Social Media geschrieben. Wer wann wo was postet, ist ebenso von Interesse, wie die Anzahl der Follower, Klicks und Kommentare. In dem er seine Protagonistin in die Welt von Stars und Sternchen katapultiert, wird eindrucksvoll illustriert, wie es den Menschen hinter diesen Zahlen geht. Sie leben abgeschottet, umgeben von Luxus. Dieses einsame Leben möchte Maya ebenso wenig führen, wie es sie unberührt lässt, dass Menschen in der Öffentlichkeit Negatives über sie berichten. Sie verliert schnell das Interesse an der öffentlichen Aufmerksamkeit und möchte dieser entkommen.
Daneben steht aber eine weitere, ebenso zentrale Frage im Zentrum des Romans: Was macht eine gute Mutter aus? Das ist ein Thema, das Autorinnen und Autoren in den vergangenen Jahren immer wieder umtreibt. Hat Maren Wuster in ihrem geschickt kombinierten Doppelroman Eine beiläufige Entscheidung die Geschichte einer Mutter erzählt, die, von der Mutterrolle völlig überfordert, Mann und Kind verlässt und von ihren schmerzenden, mit Muttermilch gefüllten Brüste daran erinnert wird, was sie hinter sich gelassen hat , so hat Verena Kessler in ihrem Roman Eva in Anlehnung an die Birthstrike-Bewegung die Frage gestellt, ob es in Zeiten des Klimawandels verantwortungsbewussten Menschen noch möglich ist, sich bewusst für ein Kind zu entscheiden. An die komplexen Strukturen dieser beiden Romane reicht der linear erzählte Text von Clemens Berger nicht heran. Dennoch fügt er dem Mutterbild eine neue, wichtige Facette hinzu, indem er seine Leserinnen und Leser mit zahlreichen Fragen konfrontiert: Darf Maya als moderne Amme ihre Milch an andere verkaufen? Ist das Selbstbild als Unternehmerin, die mit der Muttermilch ein Produkt verkauft, nicht ein zu kapitalistischer Blick auf den Körper der Frau? Schadet sie ihrer Tochter, wenn sie ihre überschüssige Milch zu Geld macht, oder tut sie ihr nicht vielmehr etwas Gutes, in dem sie für ihre Zukunft vorsorgt? Hört das Selbstbestimmungsrecht der Mutter auf, nachdem sie ein Kind geboren hat, weil dieses nun das Anrecht auf die aufopferungsvolle Pflege der Mutter hat? Berger knüpft damit an Fragen an, die auch rund um das Thema Abtreibung und Care-Arbeit von Frauen immer wieder gestellt werden. Er entwirft damit ein ebenso unterhaltsames wie eindrucksvolles Plädoyer für das Selbstbestimmungsrecht der Frau – ohne dabei die Not der Mütter aus dem Blick zu verlieren, die ihr Kind nicht stillen können oder wollen. Ist doch gerade der Stillzwang ein Mittel, um Frauen zu unterdrücken. Meine Brust gehört mir – so könnte dieser Roman auch überschrieben sein. Und es ist beruhigend, dass dieses Plädoyer für die Selbstbestimmung der Frau von einem Mann verfasst wurde.