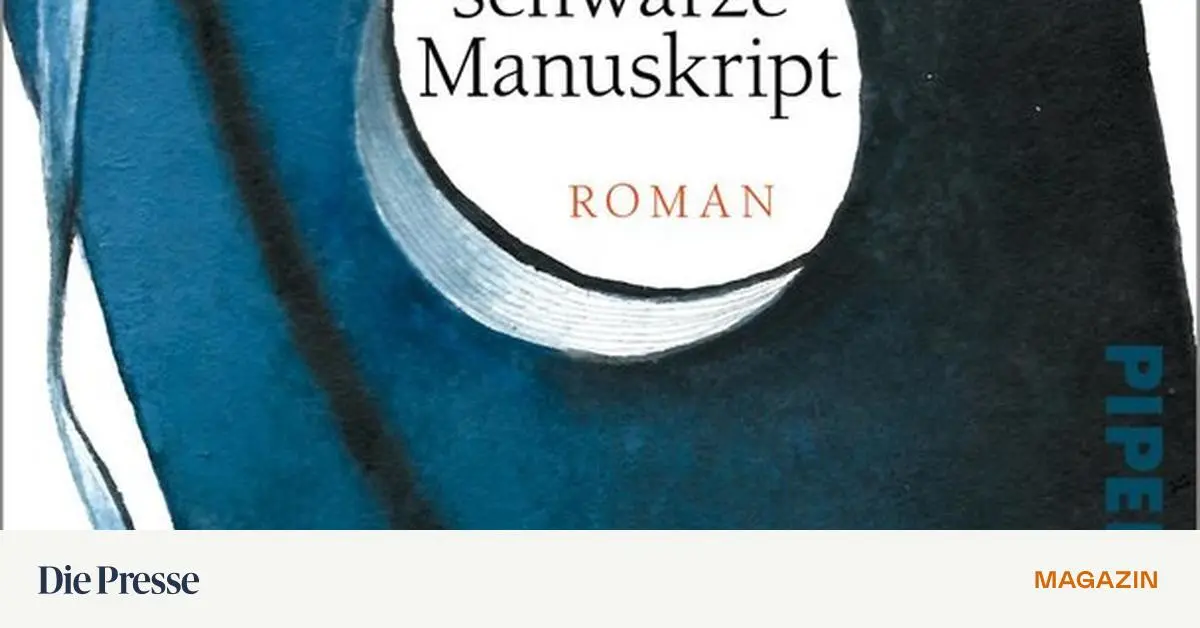Heinrich Steinfest hat einen Roman vorgelegt, in dem er Reales und Surreales kunstvoll miteinander verschränkt.
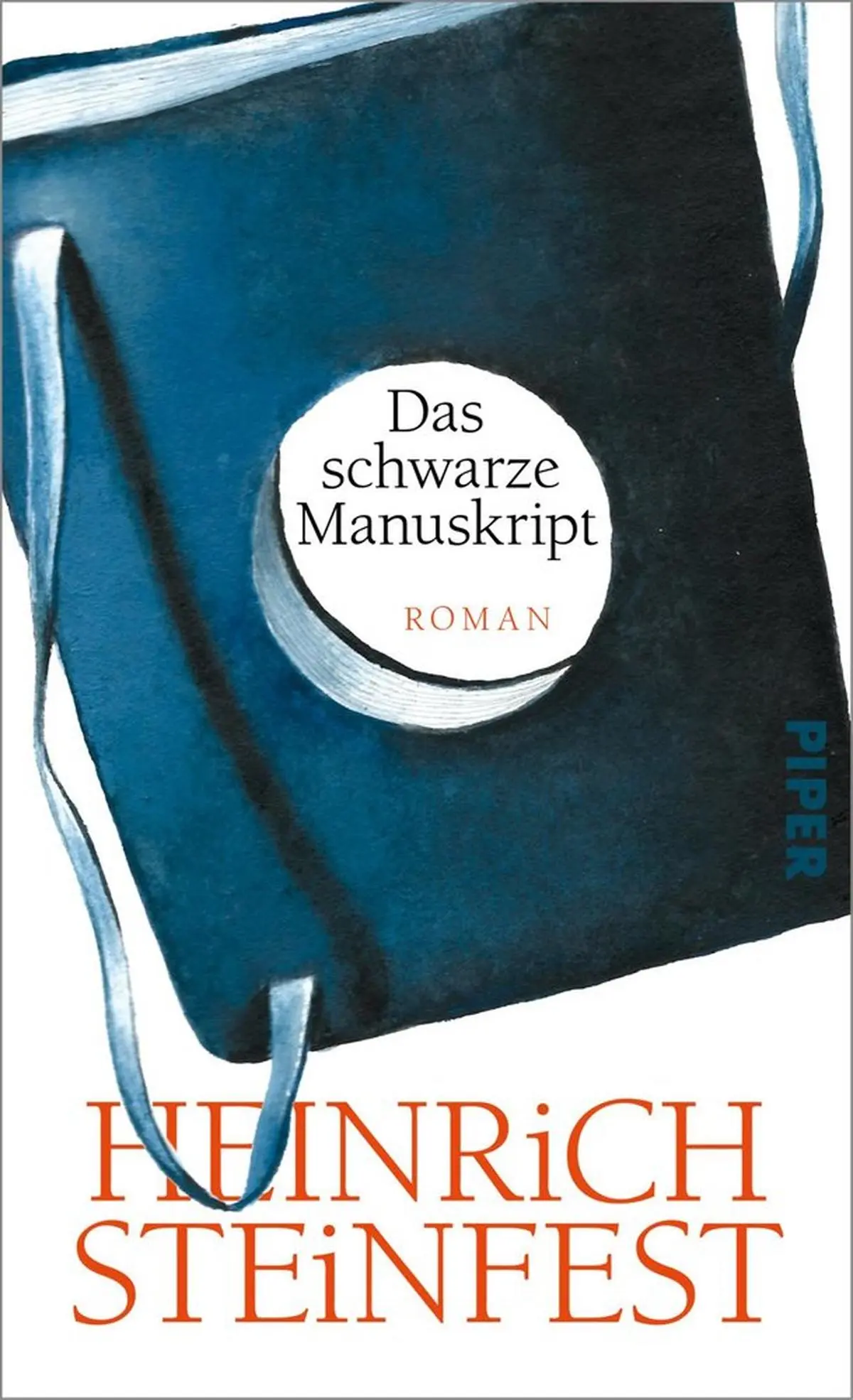
Heinrich Steinfest: „Das schwarze Manuskript“, Piper-Verlag, 240 Seiten, 24,50 Euro
Vor etwa zwei Jahren wurde im Burgtheater das Stück „Nebenwirkungen“ von Jonathan Spector gezeigt. Es gibt eine Mumps-Epidemie und fortan dürfen nur noch Schüler und Schülerinnen zum Unterricht kommen, die geimpft sind. Das führt in einer Privatschule zu einer großen Debatte, mit den sattsam bekannten Argumenten pro und kontra Impfen. Spector hat das Stück im Jahr 2018 geschrieben, ein Jahr, bevor sich Sars-CoV-2 in China ausgebreitet und zu einer Pandemie geführt hat. Hier hat ein Schriftsteller etwas erstaunlich genau antizipiert, was sich erst ein bis zwei Jahre später ereignet hat.
In Heinrich Steinfests Roman „Das schwarze Manuskript“ beschreibt ein Autor erschreckende Gräueltaten, die dann tatsächlich begangen werden – und zwar von genau jenen Personen, die der Autor in dem Text sogar namentlich nennt. Dabei konnte dieser Autor, Peter Bischof, davon gar keine Kenntnis haben.
Das Buch ist zwar unveröffentlicht, dennoch bringt es seinen Verfasser in die Bredouille. Er will das Manuskript loswerden und übergibt es einem flüchtigen Bekannten: Ashok Oswald. Der bewahrt das Typoskript viele Jahre bei sich zu Hause auf. Es ist das einzige Exemplar, denn es sind die frühen 1980er-Jahre, der Text wurde auf Schreibmaschine getippt und Bischof hat keine Kopie gemacht. Ashok Oswald legt es in eine Kiste in seinem Keller und vergisst es. Bis plötzlich Unbekannte auftauchen und das gebundene und mit Schwarzschnitt versehene Manuskript vehement einfordern.
Während „Das schwarze Manuskript“ eher gemächlich beginnt, wird es jetzt turbulent. Oswald will dem Mysterium rund um das Manuskript auf den Grund gehen. Dabei ist dieser Mann kein Abenteurer, im Gegenteil. Steinfest schildert seinen Protagonisten als einen übervorsichtigen, leicht paranoiden Mann, vernünftig, strebsam, erfolgreich – er ist inzwischen der CEO eines multinationalen Konzerns – und ein Langweiler. Auch emotional ist er eher unterentwickelt. Als sich seine zweite, weitaus jüngere, schöne Frau von ihm trennt, sagt sie, Ashok wisse gar nicht, was Liebe eigentlich sei. Er nimmt es gelassen.
Alte Liebe, neu entfacht: Er 60, sie 80
Diese etwas klischeehaft anmutende Situation ändert sich, als Oswald auf einer Reise eine ehemalige Geliebte wiedersieht. Sie war einst eine gefeierte Schauspielerin, hat sich aber auf ein französisches Weingut zurückgezogen. Inzwischen ist sie achtzig, fast zwanzig Jahre älter als Oswald. Obwohl sie ihr Alter keineswegs verleugnet, übt sie neuerlich eine große Anziehung auf ihn aus. Die alte Liebe erwacht, wie es sich Jacques Brel in dem berühmten Chanson „Ne me quitte pas“ wünscht, in dem es heißt, dass man oft schon Vulkane gesehen habe, deren Feuer wieder entflammt sei, obwohl man gedacht habe, sie seien erkaltet. Diese Passagen gehören zu den schönsten in dem Buch.
Hier aber ist die Reise nicht zu Ende, es wird immer bunter und skurriler. Steinfests Fabulierlust und -können sind also nicht erloschen wie alte Vulkane. An einer Stelle fragt Oswald die Schauspielerin, warum der Autor, Peter Bischof, das Manuskript nicht einfach vernichtet und geschworen habe, nie wieder eines zu verfassen. „Schreiben ist eine Krankheit, an der man ein Leben lang laboriert“, antwortet die Schauspielerin. Diese Krankheit hat auch Heinrich Steinfest im Griff. Obwohl „Das schwarze Manuskript“ vollkommen anders ist, erinnert der Roman immer wieder an ein lang zurückliegendes Buch dieses Autors: „Das grüne Rollo“. Beide – Manuskript und Rollo – sind Portale zu einer parallelen Welt.
Nicht ganz so eingefleischte Steinfest-Leser und -Leserinnen werden sich eventuell daran stoßen, dass der Autor zu Beginn ein paar Fußnoten in den Roman einbaut, die den Fluss stören. Es sind glücklicherweise nur vier, denn die Verfremdung wirkt ein wenig gewollt und manieriert.
Steinfest-Fans aber werden sich wieder an den unzähligen Details aus Kunst- und Kulturgeschichte erfreuen. An den mannigfaltigen, manchmal auch selbstreferenziellen Anspielungen und an dem kunstvoll ineinander verschachtelten und mehr und mehr surreal anmutenden Plot – diesem ausgeklügelten Vexierspiel um ein Manuskript, das einen in eine andere Welt lockt, wie das ja alle Romane tun.
Lesen Sie mehr zu diesen Themen: