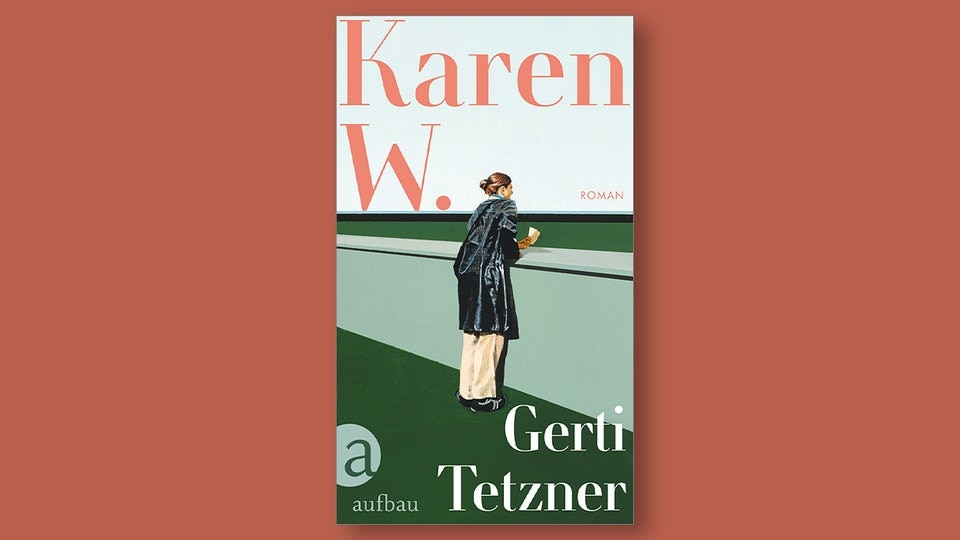Karen Waldau ist 29 und hat eine siebenjährige Tochter, als sie eines Nachts beschließt, ihren Mann zu verlassen. Sie steigt in den ersten Zug, der sie von Leipzig in das thüringische Dorf bringt, in dem sie aufgewachsen ist. Dort arbeitet die studierte Juristin in einer LPG und denkt darüber nach, wie es mit ihr und dem Kind weitergehen soll. Sie erinnert sich an ihre Kindheit und Jugend, an ihre erste Begegnung mit ihrem Mann und daran, wie sie immer wieder versucht hat, aus den Pfaden, die die DDR jungen Menschen vorgibt, auszubrechen.
Es ist eine einfache Geschichte, die Gerti Tetzner hier erzählt und doch ist sie kompliziert. Denn Identitätssuche, weibliche Selbstbestimmung und kritisches Denken sind in dem Land, in dem diese Geschichte spielt, nicht vorgesehen.
Gerti Tetzner schreibt inspiriert vom eigenen Leben
Bereits 1974 schreibt Gerti Tetzner das, was man heutzutage „Autofiktion“ nennt. 1936 in Wiegleben, heute ein Stadtteil von Bad Langensalza, geboren, studiert sie wie ihre Protagonistin Karen Jura. Auch, weil ihr Vater Nationalsozialist war und sie meint, etwas wiedergutmachen zu müssen. Weil sie jedoch nicht über Republikflüchtige urteilen will, gibt sie den Beruf der Juristin auf. Sie arbeitet in Industriebetrieben, bevor sie 1966 ein Studium am Leipziger Literaturinstitut beginnt. Doch zwei Jahre später wird sie exmatrikuliert – nachdem sie den Einmarsch russischer Truppen in Prag nicht gutheißen will. Heute lebt die betagte Autorin in Berlin und ist selbst überrascht über das große Interesse an ihrem alten Romandebüt.
Mit Christa Wolf befreundet
Zum Schreiben fühlt sich Gerti Tetzner vor allem von Christa Wolf ermutigt. Die Autorin hatte ihr auf einen Brief geantwortet und wird später zu einer guten Freundin. Der Roman „Karen W.“ erinnert in seiner klaren Sprache und seiner genauen Beschreibung der Lebensumstände in der DDR auch an die Bücher von Christa Wolf oder Brigitte Reimann.
Wie bei den weit bekannteren Schriftstellerinnen verknüpft Gerti Tetzner eindrucksvoll die Realität des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaates mit den Wünschen und Sehnsüchten einer jungen Generation, deckt Widersprüche und Irrwege auf. So fragt sich Karen einmal: „Was war das bloß für eine Zeit und ein Land um mich rum? Immer blieb ich für oder gegen was verwickelt, und immer traf jede Wahl die ungewählte Kehrseite mit. Gab’s denn nie ein vollkommenes rundes Ja? Nicht mal in der Liebe?“
Blick von der DDR auf heute
Zugleich schwingt im Roman immer der Idealismus und Optimismus der Autorin und ihrer Protagonistin mit – trotz realsozialistischer Mühen historisch auf der „richtigen Seite“ zu stehen. Ein bisschen Pathos gehört unbedingt dazu, wenn Karen für sich meint: „Groß und rein muss der Mensch leben, mit ungebrochenen Flügeln.“
Was war das bloß für eine Zeit und ein Land um mich rum? Immer blieb ich für oder gegen was verwickelt, und immer traf jede Wahl die ungewählte Kehrseite mit.
aus „Karen W.“ von Gerti Tetzner
Nicht wenige Vertreterinnen und Vertreter der jungen Schriftstellergeneration beschäftigen sich gerade mit dem Erbe der DDR, mit ihren Auswirkungen auf die Gegenwart. Der Roman „Karen W.“ erweitert diesen Horizont, weil er aus der DDR herausgeschrieben wurde und ihr Ende noch nicht mitdenkt. Dabei erzählt Gerti Tetzner sehr wahrhaftig von einer jungen Frau, die den jungen Menschen von heute gar nicht unähnlich ist. Karen Waldau hat Träume und Ideale, muss aber feststellen, dass dafür in der Wirklichkeit nur wenig Raum ist. Die Wiederentdeckung des Romans „Karen W.“ über fünfzig Jahre nach seinem Erscheinen ist ein Glücksfall für die deutsche Gegenwartsliteratur.