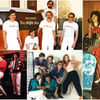„Vor zwei Jahren hat sich mein Leben grundlegend verändert.“ So beginnt Stefanie Stöferle, wenn sie erklären will, was hinter ihrer Arbeit und ihrem Engagement steckt. Damals hat die jetzt 35-Jährige aus Ingerkingen ihre Diagnose für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bekommen, und dass sie auf dem Autismus-Spektrum liegt. Heute setzt sie sich ein für Inklusion und mehr Verständnis dafür, dass nicht jedes Gehirn gleich funktioniert. Eine große Stütze und ein wichtiges Medium dabei: ihre Kunst.
Ich habe immer versucht, mich anzupassen.
Stefanie Stöferle
Am 11. September findet Stöferles erste Vernissage in Steigmillers Hofladen in Ummendorf statt. Es werden verschiedene ihrer Bilder zu sehen sein, in denen sie Worte und Texte eingearbeitet hat. Sie will damit zum Nachdenken anregen, eine Brücke schlagen von Ahnungslosigkeit zu Verständnis, einen „anderen Blick“ gewähren, wie auch der Titel der Ausstellung lautet – mehr verrät die Künstlerin noch nicht. „Der Fokus soll nicht so auf den Bildern selbst liegen, sondern mehr auf der Intention dahinter.“
Empfohlene Artikel
Und die ist klar: durch Wissen Verständnis schaffen für „die Vielfalt unserer neurologischen Abläufe im Gehirn und die daraus resultierenden Reaktionen und Symptome“.
Man spreche oft darüber, wie wichtig Biodiversität für die Welt sei, aber Neurodiversität sei ebenso existentiell, findet Stöferle. Der Begriff „Neurodiversität“ beschreibt, dass Menschen Informationen, Gefühle und Eindrücke auf unterschiedliche Weise verarbeiten, wie eben bei ADHS oder Autismus. Diese Unterschiede gehören in diesem Verständnis zur natürlichen Vielfalt der Menschen – so wie es auch verschiedene Haarfarben oder Körpergrößen gibt.
Sie fand sich selbst in den Beschreibungen von Autismus
Stefanie Stöferle hatte ursprünglich begonnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um ihren Sohn mit Down-Syndrom besser begleiten zu können, der ebenfalls auf dem Autismus-Spektrum liegt. Doch dann hat sie auch sich selbst in den Beschreibungen wiedergefunden. Seitdem hat sie viel Zeit darin investiert, mehr über Neurodiversität zu lernen, hat Workshops und Fortbildungen besucht, sich um ihre eigene Diagnose bemüht und einen Lehrgang für Malbegleitung mit kunsttherapeutischen Tools gemacht. Schnell war ihr klar: Sie möchte in dem Bereich arbeiten.
Empfohlene Artikel
Für sie war die Diagnose eine große Erleichterung. „Ich habe immer versucht, mich anzupassen, mich in irgendwelche Nischen zu drängen“, erzählt sie. Geklappt hat das nie. Mit der Diagnose hatte sie auf einmal eine Erklärung für all die Zweifel. Sie kämpft zum Beispiel oft mit Reizüberflutung. Während des Gesprächs an ihrem Esstisch schildert sie, wie sie gleichzeitig die tickende Uhr in der Ecke, das Radio im Wohnzimmer, sogar den Kühlschrank in der Küche hört, und alles gleich laut wie das Gespräch. „Es bedeutet für mich viel Energieaufwand, das irgendwie auszublenden.“
Jungen bekommen häufiger eine ADHS-Diagnose
Wie sie eine Diagnose zu bekommen, sei aber oft nicht einfach, weiß sie von anderen Betroffenen, auch die Dunkelziffer könne sehr groß sein, betont sie. Bekannt ist: Etwa fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen weltweit haben ADHS und rund 70 Prozent aller Betroffenen zeigen auch als Erwachsene noch Symptome, so Zahlen, die das zentrale ADHS-Netz zitiert. Allerdings zeigen zum Beispiel Frauen und Mädchen oft andere Symptome als Jungen oder Männer, wodurch sie häufig übersehen werden. Eine große Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (die KiGGS-Studie) hat schon 2018 gezeigt, dass Jungen deutlich häufiger als Mädchen eine ADHS-Diagnose erhalten.
„Es ist eine absolute Vollkatastrophe“, beschreibt Stöferle es. Die Ärzte seien oft überlastet, manchmal würden sie auch die neuesten Erkenntnisse in dem Bereich nicht kennen und noch auf Basis der Kommentare in einem Schulzeugnis urteilen. Doch ADHS sei eben nicht nur der klassische „Zappelphilipp“, sondern kann sich zum Beispiel auch in stillen Träumereien oder Vergesslichkeit ausdrücken. Auch beim Autismus-Spektrum gebe es noch viele veraltete Vorstellungen, es bedeute zum Beispiel nicht „fühlt nichts“, sondern viel mehr„fühlt zu viel“, ergänzt Stöferle.
Mit ihrer Vernissage will sie einen kleinen Teil dazu beitragen, mit solchen Vorurteilen aufzuräumen. Einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf ihrer Bilder will sie zudem spenden – an wen, das enthüllt sie erst am Abend selbst. „Wir müssen einfach weiter darüber reden, so lange, bis es normal wird.“ Die Vernissage mit musikalischer Begleitung beginnt um 19.30 Uhr.