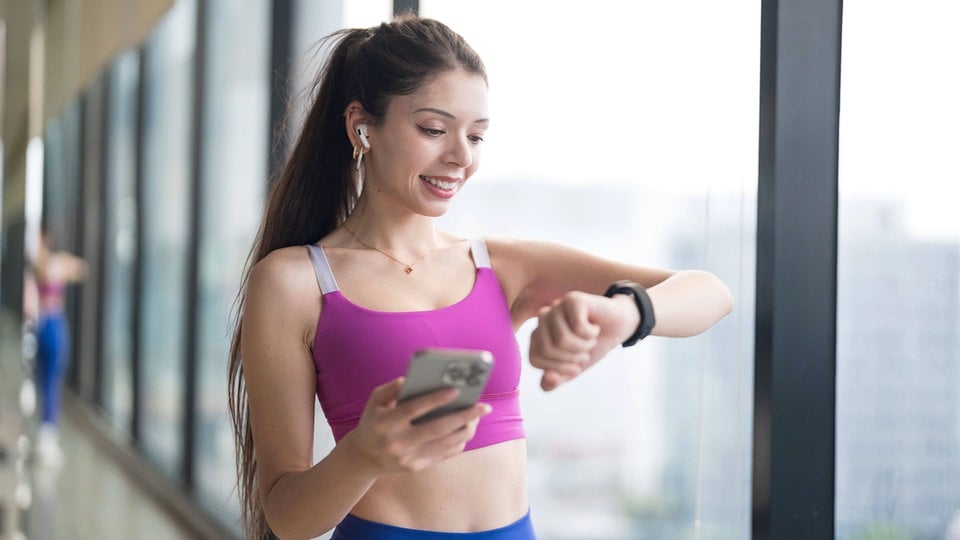Frauen geben durchschnittlich deutlich mehr für Gesundheit und Wellness aus als Männer – in Deutschland gaben Frauen im Jahr 2020 5.690 Euro pro Kopf aus. Männer nur 4.690 Euro. Dabei geht es auch um ärztliche Behandlungen – aber grundsätzlich sind Frauen bereit, mehr Geld für ihre Gesundheit, Nahrungsergänzung und Prävention auszugeben, als Männer. Möglicherweise wächst der FemTech-Markt auch deshalb so kräftig, weil er eine zahlungsbereite Zielgruppe erschließt.
Weibliche Gesundheitsdaten fehlen
Allerdings muss man auch festhalten: Für viele FemTech-Anwendungen und -Produkte liegt der Nutzen entweder auf der Hand oder ist durchaus wissenschaftlich untermauert. Viele FemTech-Anwendungen erheben darüber hinaus eine ganze Reihe an Daten über den weiblichen Körper. Beispielsweise, weil ihre Nutzerinnen den Puls tracken oder die Symptome ihrer Endometriose. Und diese Daten fehlen der medizinischen Forschung eigentlich schon immer. „Das ist zum Großteil noch historisch bedingt, weil man früher Frauen im gebärfähigen Alter ausgeschlossen hat“, erklärt Carina Vorisek vom deutschen Ärztinnenbund. Erst seit den neunziger Jahren gebe es die Empfehlung, Frauen auch einzubeziehen.
Bis heute gilt der weibliche Körper als unterforscht. Man nennt das den „Gender Health Gap“. Können die Daten aus den FemTech-Anwendungen diese Lücke für die medizinische Forschung zumindest ein Stück weit schließen? Einige Unternehmen sammeln in diesem Zusammenhang aktuell durchaus sehr wertvolle Daten, findet Vorisek: „Ich denke da an ein Start-up aus den USA, die entwickeln einen BH, der EKG-Daten erhebt.“ Gerade in der Kardiologie, wenn es etwa um Herzinfarkte gehe, seien Frauen stark unterdiagnostiziert, weil sie andere Symptome haben. „Da ist das natürlich eine super Möglichkeit, zusätzliche Daten zu erheben.“ Sie sehe das als große Chance.
Zwischen sinnvollen und sinnlosen Apps zu unterscheiden, ist schwer
Angesichts des großen Marktes für FemTech-Produkte ist es für viele Anwenderinnen schwer, zwischen eher sinnvollen und weniger sinnvollen Apps zu unterscheiden. „Bei den Apps auf dem freien Markt ist es schwer, pauschal zu sagen, ob die eher einen Nutzen haben oder nicht“, findet Carina Vorisek. „Was mich persönlich immer ein bisschen verschreckt, ist wenn die Gründer eines FemTech-Unternehmens hauptsächlich männlich sind“, ihr sei weibliche Repräsentation in diesem Zusammenhang wichtig.
Darüber hinaus helfen Zertifizierungen, ein Angebot zu finden, das auch aus medizinischer Sicht sinnvoll ist. „Wenn die Apps über die Krankenkassen veröffentlicht wurden oder als sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen klassifiziert sind, sind die Hürden schon wirklich hoch.“ Carina Vorisek erklärt, dort könne man darauf vertrauen, dass ein Nutzen erst einmal nachgewiesen werden musste.
Auf den Datenschutz achten!
Auf der anderen Seite steht der Datenschutz. Es geht bei den meisten FemTech-Anwendungen immerhin um hochsensible Gesundheitsdaten. In den USA etwa wurden Zyklus-Apps bereits im Rahmen der Strafverfolgung illegaler Abtreibungen genutzt, weil sie Hinweise auf eine beendete Schwangerschaft geben können.
In Deutschland gibt es vergleichsweise strengere Datenschutzbestimmungen, die sich etwa aus der Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV) ergeben. Apps müssen bei der Informationssicherheit, Zweckbindung, Datenminimierung und Nutzeraufklärung bestimmte Standards erfüllen. Auch für Apps etwa aus den USA, die in Deutschland verwendet werden, gelten die Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Aber dabei gibt es ein Problem: Nicht alle FemTech-Apps sind beispielsweise als Medizinprodukte zugelassen. Zyklus-Apps etwa, die nur der Beobachtung des eigenen Zyklus dienen, gelten als Lifestyle-Produkt und müssen die strengen Vorgaben für Medizin-Apps nicht erfüllen. Es gilt also immer, zu prüfen, woher eine App stammt und welche Vorgaben dementsprechend gelten.