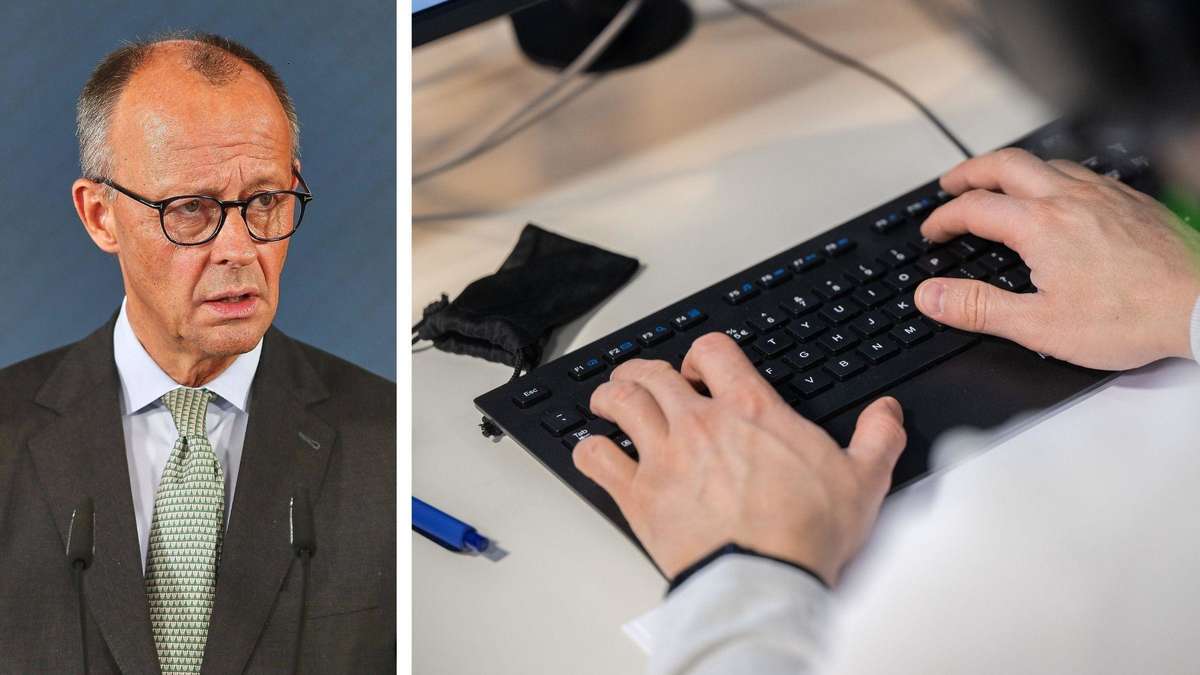DruckenTeilen
Union und SPD wollen das Arbeitszeitgesetz reformieren. Die Reaktionen fallen gespalten aus, mitunter gibt es scharfe Kritik. Nun auch von Forschenden.
Frankfurt am Main – Grundsätzlich dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland nicht über acht Stunden am Tag arbeiten, wobei in Ausnahmefällen bis zu zehn Stunden möglich sind. Festgeschrieben ist das im aktuell gültigen Arbeitszeitgesetz, doch genau das will die Regierung um Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angehen: Bereits im Koalitionsvertrag einigten sich Union und SPD darauf, eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen zu wollen. Welche Szenarien aber könnte eine Novelle des Arbeitszeitgesetzes für Arbeitnehmer bereithalten?
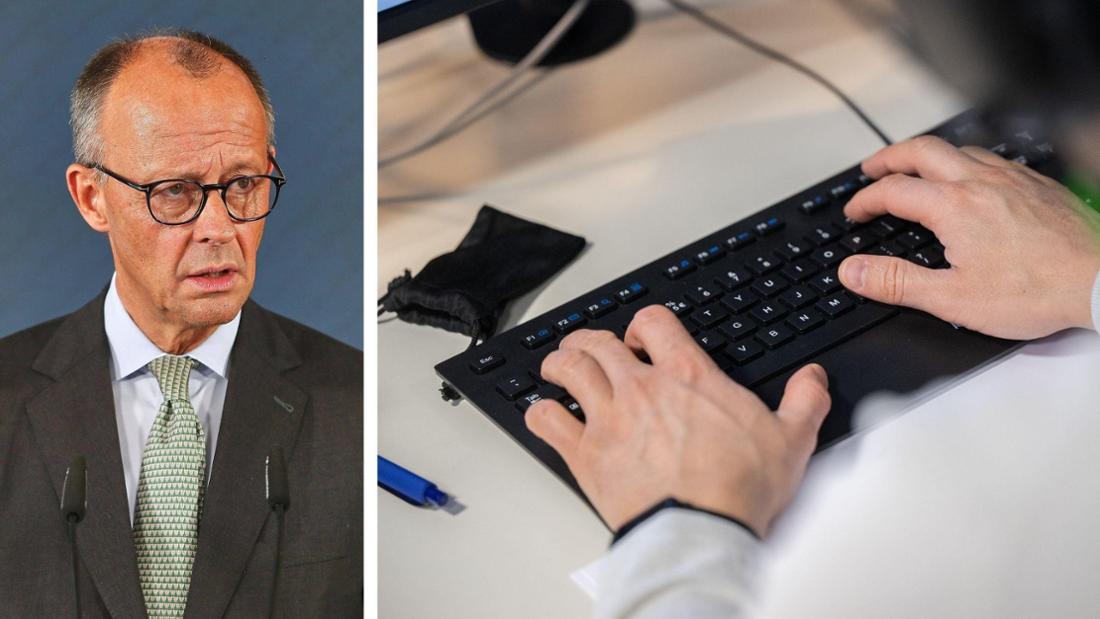 Fotomontage Friedrich Merz‘ (CDU) und einem Beschäftigten im Büro © IMAGO / dts Nachrichtenagentur und picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
Fotomontage Friedrich Merz‘ (CDU) und einem Beschäftigten im Büro © IMAGO / dts Nachrichtenagentur und picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
Mit einem neuen, überarbeiteten Arbeitszeitgesetz will die Bundesregierung Beschäftigen mehr Flexibilität bei der Arbeit ermöglichen, außerdem sollen ökonomische Impulse gesetzt und das Arbeitsvolumen dem demografischen Wandel zum Trotz erhalten werden. Das bislang gesetzte grundsätzliche Arbeitspensum von maximal 40 Stunden, mit jeweils acht, beziehungsweise in Ausnahmefällen zehn Stunden täglich, könnte den Vorstellungen der Bundesregierung zufolge bald passé sein.
Diese Neuerungen plant die Merz-Regierung mit der Arbeitszeitgesetz-Reform
Statt der wöchentlichen Obergrenze von 40 Stunden soll den Vorstellungen von Regierungsvertreterinnen und -vertretern zufolge eine wöchentliche Obergrenze von 48 Stunden gelten, wie mehrere Medien – darunter n-tv und der Staatsanzeiger – zuletzt berichteten. Laut Berechnungen des Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht (HSI) der Hans-Böckler-Stiftung würde dies Arbeitstage von bis zu 12 Stunden und 15 Minuten erlauben – und damit deutlich mehr tägliche Arbeitszeit als die derzeit geltende Höchstgrenze von 10 Stunden.
Wer einen Tag länger als acht Stunden arbeitet, soll den Vorstellungen der Regierung an anderen Tagen mit weniger Arbeit ausgleichen können. An anderen Tagen bliebe damit mehr Zeit für Familie und andere private Angelegenheiten. Jedoch würde mehr als die Hälfte der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitszeiten dagegen lieber generell verkürzen.
Minister unter Merz: Komplette Liste des Kabinetts – von Klingbeil bis zu „neuen Gesichtern“ Fotostrecke ansehen
Fotostrecke ansehen
Nach Ansicht von Unions- und SPD-Politikerinnen und -Politikern soll die Reform des Arbeitszeitgesetzes auch dazu beitragen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Von der flexibleren Arbeitszeitgestaltung erhoffen sich CDU/CSU- und SPD-Angehörige, dass mehr Menschen – und unter ihnen etwa Eltern, pflegende Angehörige oder ältere Beschäftigte – wieder eine Arbeit aufnehmen. Doch auch Unternehmen sollen von der Aufweichung der aktuell geltenden Arbeitszeit-Rahmenbedingungen profitieren: Und zwar, indem sie mit dem flexibleren Arbeitszeitmodell adäquater auf Auftragsspitzen reagieren und ihre Beschäftigten bedarfsgerechter einsetzen können.
Neue HSI-Analyse kritisiert die Pläne zur Arbeitszeit-Reform vehement
Die Reaktionen auf den bisherigen Ansatz der schwarz-roten Regierungskoalition zur Überarbeitung des Arbeitszeitgesetzes fielen jedoch denkbar verschieden aus. Der Verband der bayerischen Wirtschaft (vbw) etwa begrüßte die Idee einer Anpassung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Seine Vertreterinnen und Vertreter wandten sich etwa gegen den oft vorgebrachten Einwand, Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden täglich seien gesundheitsgefährdend: So behaupteten vbw-Angehörige, das gesundheitsgefährdende Potenzial langer Arbeitstage werde ganz einfach dadurch ausgeglichen, dass an anderen weniger gearbeitet wird.
Dieser Ansicht widersprechen HSI-Vertreterinnen und -Vertreter jedoch deutlich: Arbeitsmedizinisch sei längst erwiesen, dass Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden die Gesundheit gefährden, so das Institut. Langfristig komme es auf. Diese Weise häufiger zu stressbedingten Erkrankungen, und darunter auch zu psychischen Erkrankungen und Burnout-Symptomatiken sowie physischen und psychischen Erschöpfungszuständen. Aber auch das Potenzial für körperliche Erkrankungen – darunter Schlaganfälle, Diabetes und ein erhöhtes Krebsrisiko – gehen laut dem HSI von Arbeitstagen aus, die acht Stunden überschreiten.
Dr. Amélie Sutterer-Kipping und Dr. Laurens Brandt vom HSI argumentieren, die von der Bundesregierung angeführten Ziele ließen sich durch deregulierte Arbeitszeiten nicht erreichen. Denn neben dem gesundheitsschädlichen Potenzial längerer täglicher Arbeitszeiten dürfte sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht erheblich verbessern. Im Gegenteil: „Die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von Arbeitszeiten stellen wichtige Schlüsselfaktoren für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar“, argumentieren die HSI-Forschenden. (Quellen: Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht (HSI), Verband der bayerischen Wirtschaft, n-tv, Staatsanzeiger) (fh)