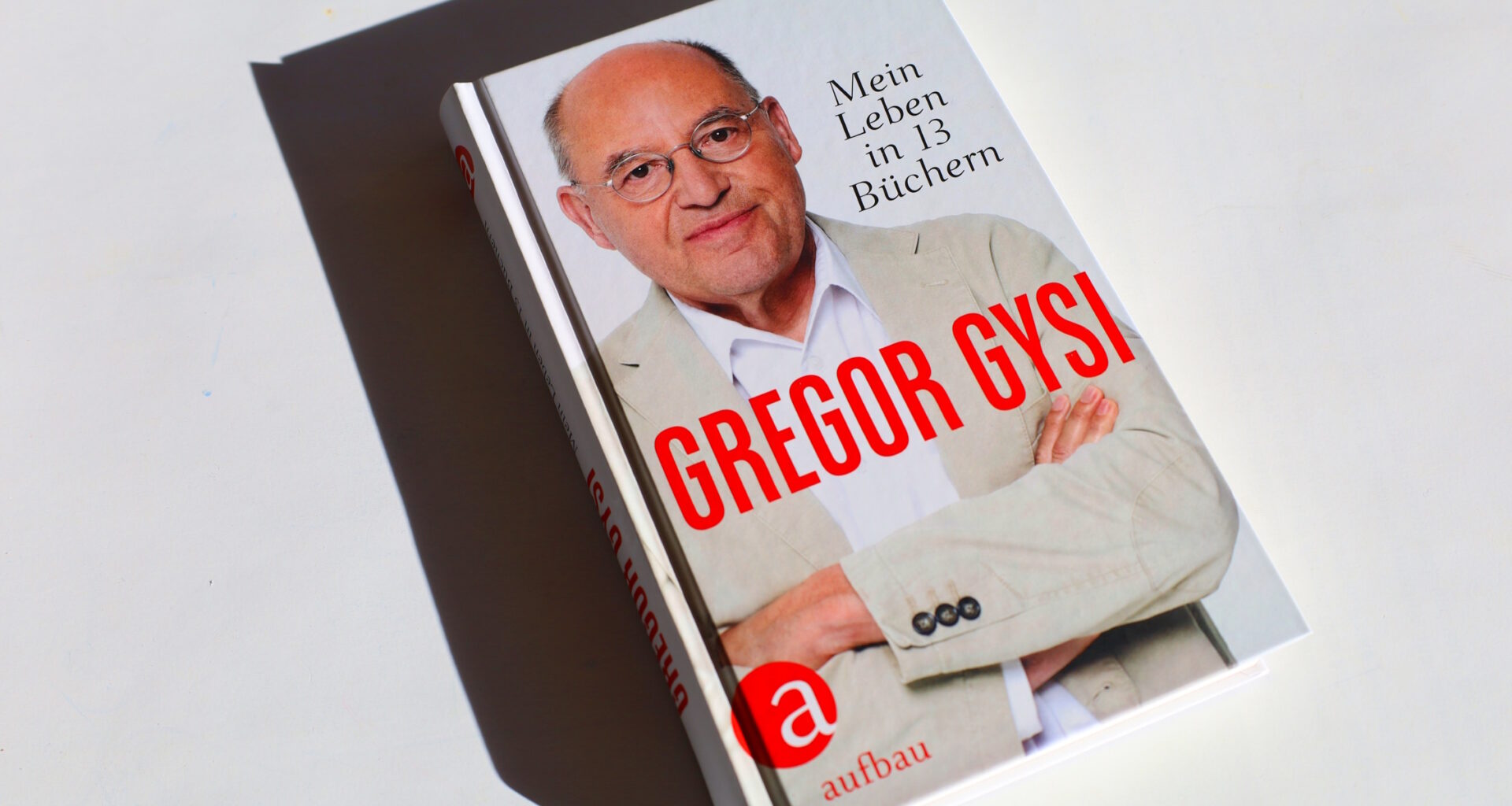Kommt man als Politiker überhaupt noch zum Lesen? Gehört Lesen eigentlich zur Bildung eines Politikers? Das sind so eher beiläufige Fragen, die vor einem aufploppen, wenn man den wohl bekanntesten Linken jetzt auch noch in seiner Bibliothek besucht. Zumindest beinahe. Denn was er mit Hans-Dieter Schütt zusammen ausgesucht hat, sind 13 Bücher, die für ihn prägend waren.
Denn Gysi ist einer, der weiß, wie einen gut erzählte Geschichten fürs Leben prägen können. Und 13 ist eher auch nur eine Auswahl. Aber es geht ja um Geschichten.
Nicht um Rezensionen oder Bewertungen dieser Bücher. Das will Gysi auch gar nicht, der sich mit Schütt auch auf mehrere kleine Dispute über das Lesen, die Wörter, die Rolle von Literatur in der Politik einlässt. Da spielen sie sich die Bälle zu, machen sich auch auf freundliche Art über die großen Klassiker lustig. Aber beide wissen: Es gibt die Macht des Wortes. Und zwar nicht nur am Rednerpult des Bundestages, wo Gregor Gysi nun seit über 30 Jahren zu einem der begabtesten Redner gehört. Sondern auch beim Lesen von Büchern.
Was man vielleicht nicht in der Schule erfährt. Auch Gysi hat einige ziemlich schlechte Erinnerungen daran, was da in seinem Deutschunterricht an Literatur angeboten wurde. Da ging es eher um Erziehung, aber nicht um die Macht der Worte. Oder die Schönheit von Texten und die Wirkung guter Geschichten.
Was Gysi für dieses Buch ausgewählt hat, sind dann auch nicht seine „Bücher, die man unbedingt gelesen haben sollte“. Hitlisten und „Die 100 wichtigsten Bücher von Dings und Bums“ sind nicht seine Sache. Schon im Gespräch mit Schütt merkt man: Dieser Politiker liest wirklich. Und er hat Bücher auf sich wirken lassen, deren Geschichten ihn beeindruckt haben.
Darunter natürlich einige, die man bei einem ostdeutsch geprägten Autor erwarten kann, weil sie auch Schulstoff waren. Was schlimm genug ist. Denn das führt oft genug dazu, dass diese Bücher bei den Schülern dann regelrecht fürs Leben verbrannt sind. Aber Gysi hat einige ganz offensichtlich verschlungen. Und sie haben ihn ein Leben lang weiter beschäftigt, weil sie Fragen behandeln, die auch heute noch virulent und hochaktuell sind.
Untertan, Bibel und Kommunismus
Und warum sie das sind, das erzählt er in seinen kleinen Essays zu Heinrich Manns „Der Untertan“, zu Goethes „Faust“, zu Thomas Manns „Mario und der Zauberer“ oder Lessings „Nathan der Weise“ sehr locker und nachvollziehbar. Da merkt man nichts von den starren Interpretationsformeln, mit denen der Schulunterricht Bücher regelrecht erschlagen kann. Man erkennt vielmehr genau diesen Gysi, der auch am Rednerpult gern Geschichten erzählt. Er liebt Geschichten und lässt sich genau von diesen in ihren Bann schlagen.
Aber auch anregen, die von genialen Erzählern gestalteten Fabeln in unserer ganz und gar nicht unproblematischen Zeit auch wiederzuerkennen. Etwa wenn er den Charakter des Untertanen in Heinrich Manns Roman genauer betrachtet, der ihm mit Blick auf die Gegenwart doch verdächtig bekannt vorkommt: „Der Untertan hat Angst vor sich selbst.
Doch indem er diese Angst verdrängt, schafft er in sich selbst immer wieder die Voraussetzung, aufs Neue steuerbar zu werden“, stellt Gysi fest. „Wenn man sich von den Leuten unterscheiden will, muss man ein Charakter sein. So die Zumutung, die von Demokratie ausgeht, bis heute.“
Und da hat ihn dann eben auch das Bild aus der DEFA-Verfilmung von 1951 zutiefst beeindruckt: „Diederich Heßling rennt neben der Kaiserkutsche her. Es wird schon laufen, sagt dieser Typus. Abwarten, sagt die Geschichte und lacht. Der Untertan lacht zurück. Bis ihn die Geschichte überrollt.“
Gysi zeigt, wie man mit Büchern umgehen kann, wie man sich selbst und seine Zeit in ihnen gespiegelt sieht. Und wie sie zur Anregung werden, das eigene Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten und dabei immer wieder überraschende Aha-Effekte zu bekommen.
Was Gysi selbst bei Büchern wie der von Luther übersetzten Bibel oder beim „Kommunistischen Manifest“ von Karl Marx und Friedrich Engels so geht, das bis heute ein utopischer Entwurf für ein anderes Denken über Gesellschaft geblieben ist. Den er natürlich auch dazu nutzt, über die gescheiterten Utopien des Staatssozialismus nachzudenken und über die Frage, ob es aus der kapitalistischen Gesellschaft heraus überhaupt noch Visionen für ein anderes Miteinander geben kann.
Der Traum des kleinen Paul
Was eigentlich nicht nur Linke beschäftigen sollte. Auch deshalb ist Gysis kleine Auswahl geradezu herzerwärmend. Denn gute Literatur schafft in unseren Köpfen nun einmal tatsächlich den Raum für neue Gedanken, andere Perspektiven. Oder einfach die Fähigkeit, auch unsere Träume zu hinterfragen. Als erfahrener Leser im gestandenen Alter formuliert Gysi so auch die lang anhaltende Wirkung eines Kinderbuchklassikers von 1942: „Paul allein auf der Welt“ von Jens Sigsgard.
Ein Buch, über das Kinder völlig anders nachdenken als Erwachsene, die jetzt wie Gysi auf einmal bemerken: Es geht darin eigentlich um die Fragen von Alleinsein und Einsamkeit. Und damit um das immer komplizierte Verhältnis zu anderen Menschen. „Pauls Geschichte ist ein Gleichnis. Mitten im erwünschten Alleinsein wächst die Sehnsucht nach anderen Menschen; und inmitten der anderen lebt der Wunsch, ganz für sich zu sein.“
Wie ging und geht man damit im eigenen Leben um? Und erlebt man nicht auch im Opa-Alter, wie einen das Ende der Geschichte mitreißt, weil man es genauso nachfühlen kann, wie Paul sich auf einmal beim Aufwachen riesig freut, dass seine Eltern da sind?
Der Mensch, dieses widersprüchliche Wesen. Ihm begegnet man auch in Gysis Exkursen zu Rosa Luxemburgs „Briefen aus dem Gefängnis“ und einem weiteren Kinderbuchklassiker: Kurt Helds „Die rote Zora und ihre Bande”. Ein Buch, in dem ja ebenfalls ein Grundthema unserer Zeit berührt wird. Gysi: „Es interessierte mich, wie von bedingungsloser Solidarität unter widrigsten Bedingungen erzählt wird, von einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, von Wagemut, Begeisterungsfähigkeit und liebevoller Bindung aneinander.“
Da steckt nun einmal die Vorstellung drin, was für eine Gesellschaft wir uns wünschen und welche Menschen uns im Leben begeistern. So öffnen Bücher Türen und prägen auch Haltungen. Wenn man die Geschichten denn ernst nimmt und wirklich eintaucht in die Erzählung, wie es Gysi wohl auch schon als Jugendlicher getan hat (der in einem Haushalt voller Bücher aufwuchs).
Auch wenn er im Gespräch mit Schütt und auch in zwei aus Zitaten zusammengeschweißten Dialogen mit Schiller und Büchner eher bemerkt, dass Literatur eigentlich keine große Macht hat. Eher wohl eine stille Macht, weil sie das Denken der Leser über sich selbst und die Welt verändern kann.
Eine weltbekannte Tante
Oder weil Literatur in mitreißenden Lebensgeschichten zeigt, wie Lebenserfahrungen dann auch wieder Haltungen, Erzähl- und Kritikweisen verändert. Weswegen nicht ganz zufällig auch Marcel Reich-Ranickis Buch „Mein Leben“ in Gysis kleine Auswahl geraten ist. Genauso wie Doris Lessings „Das goldene Notizbuch“, das er nicht nur ausgewählt hat, weil die Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing seine Tante ist. In diesem Beitrag beleuchtet er auch ein wenig die Geschichte seiner Familie.
Aber er empfiehlt das Buch auch, weil es eines der frühen und wirkmächtigen Bücher zur Frauenbewegung war, in dem „Freiheit, Selbstbestimmung und Intellektualität“ ganz im Zentrum stehen. Und gleichzeitig geht es um die Frage, wie wir eigentlich Geschichte erinnern, ob es überhaupt einen Konsens darüber geben kann, wie wir Geschichte wahrnehmen.
„Es ist eine paradoxe Erfahrung, gerade auf politischem Gebiet: Über die Zukunft, die völlig unbekannt ist, können wir uns oft viel schneller verständigen als bei der Erinnerung, da beginnt nichr selten ein heftiger Streit – obwohl doch die Vergangenheit hinreichend belegt, erforscht, dokumentiert ist“, schreibt Gysi. „Akten, Dossiers, Rechnungen, alles schön und gut, aber nichts davon sagt die endgültige oder absolute Wahrheit.“
So wird jedes einzelne Buch-Kapitel auch ein kleiner Ausflug in das Nachdenken über die Macht der Wörter und Erzählungen, die Wirksamkeit guter Geschichten, ihre Rolle in unserem Leben und wie sie uns eben doch immer wieder auf neue Gedanken bringen. Uns anregen, mehr wahrzunehmen als die tägliche Oberfläche.
Auf Entdeckungsreise
Am Ende versuchen sich Schütt und Gysi noch an zehn Geboten zum (richtigen) Lesen. Aber das bleibt eher ein spielerisches Versuchen. Denn die Vielfalt und Aufregung des Lesens erlebt jeder anders. Zum Glück. Zum Glück gibt es keine wirklichen Regeln dafür, denn es sind immer – das merkt Gregor Gysi an -Entdeckungsreisen.
Und eine gute Regel findet Gysi sogar bei Theodor Fontane: „Ab und zu an Theodor Fontane denken – lieber ein gutes Buch als schlechte Gesellschaft.“ Womit er allen Lesebegeisterten wohl aus der Seele sprich. Und nebenbei eben auch andeutet, dass ihn in seinem Leben deutlich mehr Bücher beschäftigt haben. Was er in einem kleinen Alphabet zum „Lesen und Schreiben“ auch durchblicken lässt.
Denn wer erst einmal mitbekommen hat, wie einen gute Literatur in neue Gedankenwelten und faszinierende Kopf-Abenteuer entführen kann, der hört nicht nach sieben oder 13 Büchern auf. Der hat daheim eine Bibliothek stehen mit lauter guten Bekannten, auch wenn man nicht immer weiß, wo nun ausgerechnet das eine Buch steht, das man jetzt unbedingt noch einmal lesen möchte.
So eine Auswahl, wie sie Gysi hier getroffen hat, kann nur zeigen, was einen an Büchern tatsächlich berührt. Oder welche Bücher einen an entscheidenden Stellen berührt haben und so zu einem echten Lebensbegleiter wurden, weil man sich immer wieder an diese Geschichten erinnert, die einen munter gemacht haben für alles Mögliche, was einem im Leben dann tatsächlich begegnet ist.
Selbst für Leserinnen und Leser, die immer noch eine Scheu vor Büchern haben, ist dieses Büchlein ein kleiner, beherzter Türöffner in die Welt der Bücher, ein Mutmacher, seine eigenen Entdeckungen zwischen Buchdeckeln zu machen. Und sich von Anderen nicht einreden zu lassen, was man unbedingt gelesen haben sollte. Denn darum geht es beim Lesen wirklich nicht.
Gregor Gysi „Mein Leben in 13 Büchern“, Aufbau Verlag, Berlin 2025, 20 Euro.