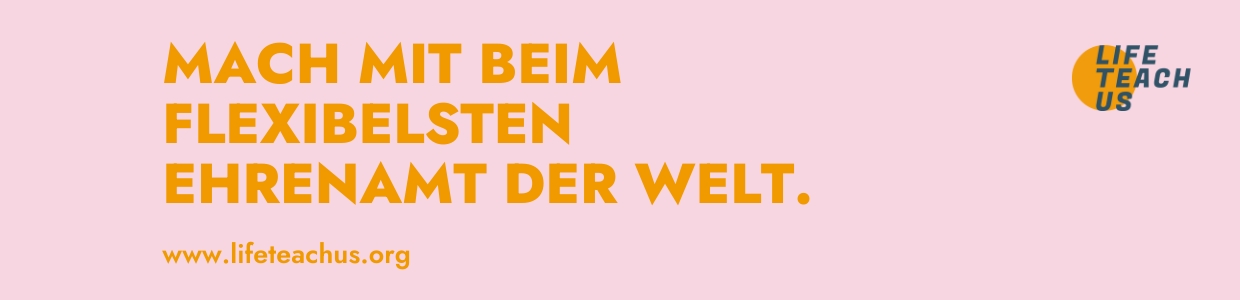Kaum errichtet, schon wieder verschwunden: Das Auswärtige Amt der DDR stand nur zwei Jahrzehnte am Schlossplatz in Berlin-Mitte. Sein Abriss wirft bis heute Fragen zum Umgang mit der Architektur der DDR-Ostmoderne sowie der Erinnerungskultur auf. Vor dem Hintergrund des anstehenden Wiederaufbaus der Bauakademie fordern nicht wenige Experten ein Erinnern an das einstige DDR-Außenministerium.
Der Schlossplatz in Berlin erzählt viele Geschichten, eine davon ist die des verschwundenen Außenministeriums der DDR. Auf diesem Foto ist das markante Gebäude im Jahr 1988 zu sehen. / © Foto: IMAGO, teutopress
© Fotos: IMAGO / Wikimedia Commons
© Foto Titelbild: IMAGO, Rolf Zöllner
Als in den 1990er Jahren die Bagger am Schlossplatz anrückten, verschwand eines der markantesten Gebäude der DDR-Geschichte. Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, einst Symbol sozialistischer Diplomatie, wurde abgetragen, um Platz für neue städtebauliche Visionen zu schaffen. Kaum ein Bauwerk der DDR-Hauptstadt stand so kurz und wurde so schnell wieder ausgelöscht.
Anzeige
Mit dem Abriss ging ein Stück jüngster Berliner Architekturgeschichte verloren, das bis heute kontrovers diskutiert wird. Befürworter sahen darin eine Befreiung von einem ungeliebten Relikt, Kritiker sprechen von einem Verlust architektonischer Substanz. Das Gebäude steht für einige Stadtentwicklungsexperten, bis heute, exemplarisch für die Debatte, wie in Berlin mit Bauwerken der DDR-Moderne umgegangen wurde.
DDR-Auswärtiges Amt am Schlossplatz: Neubau in den frühen 1970er Jahren
Errichtet wurde das Ministeriumsgebäude in den frühen 1970er Jahren auf dem traditionsreichen Areal am Schlossplatz, direkt gegenüber dem Palast der Republik. Der Baukörper war streng gegliedert, mit einer markanten Fassade aus Aluminium und Glas. Seine Architektur folgte einer nüchternen, funktionalen Formensprache, die für den internationalen Stil jener Zeit charakteristisch war.
Der Standort war nicht zufällig gewählt. Mit dem Palast der Republik und dem Staatsratsgebäude in unmittelbarer Nähe bildete das Außenministerium einen zentralen Bestandteil des politischen Zentrums der DDR. Damit wurde der Schlossplatz zur Bühne eines neuen, sozialistischen Machtzentrums in Ost-Berlin.
Funktionalität, Aluminium-Fassade und DDR-Moderne prägten den Hochhausblock in Berlins Zentrum
Das Gebäude selbst bestand aus einem Hochhausblock und einem niedrigeren Trakt, verbunden durch eine klar strukturierte Anlage. Großzügige Konferenzräume, moderne Büros und ein repräsentatives Foyer unterstrichen den Anspruch, an dieser exponierten Stelle im Zentrum Ost-Berlins internationale Diplomatie auf Augenhöhe zu betreiben. In seiner Gestaltung war der Bau typisch für den Rationalismus der DDR-Moderne.
Anzeige
Besonders auffällig war die Aluminiumfassade, die dem Gebäude eine metallisch schimmernde Präsenz verlieh. Sie sollte Fortschritt und Internationalität symbolisieren, zugleich aber auch Dauerhaftigkeit ausstrahlen. Der architektonische Ausdruck stand damit im Kontrast zum historischen Umfeld, das noch immer durch barocke und klassizistische Bezüge geprägt war.
1974 bis 1990: Ein Ministerium im Spannungsfeld von Macht und Diplomatie
Von 1974 bis 1990 war das Gebäude Sitz des DDR-Außenministeriums. Hier wurden Staatsbesuche vorbereitet, internationale Verträge verhandelt und die Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik koordiniert. Der Bau war somit nicht nur Arbeitsstätte, sondern auch Repräsentationsort.
Die Lage am Schlossplatz verstärkte diese symbolische Rolle. Während die DDR im Ausland um Anerkennung rang, sollte das Gebäude den Anspruch auf Modernität und politische Souveränität architektonisch unterstreichen. Das dominante sollte ein Signal an die Welt sein, dass die DDR ein gleichwertiger Akteur auf der internationalen Bühne sein wollte.
Abriss des Auswärtigen Amtes nach der Wiedervereinigung: Entscheidung mit Folgen
Nach 1990 verlor das Gebäude seine Funktion, das vereinigte Deutschland zog die diplomatische Arbeit in andere Strukturen um. Rasch stand die Frage im Raum, wie mit dem Bau umzugehen sei. Während einige Architekten und Stadtplaner für den Erhalt plädierten, überwog politisch der Wille zum Abriss.
1995 fiel schließlich die Entscheidung, das Gebäude vollständig zu beseitigen. Begründet wurde dies mit dem Wunsch, den Schlossplatz für eine neue Nutzung freizumachen. Damit fiel das Ministerium nach kaum zwei Jahrzehnten Nutzung der Abrissbirne zum Opfer.
Kontroversen um den Verlust: Architekten und Stadtplaner in Berlin-Mitte uneins
Der Abriss stieß auf breite Diskussionen in der Fachwelt. Viele Architekten sahen in dem Gebäude ein wertvolles Beispiel für die DDR-Moderne, das unbedingt hätte erhalten werden müssen. Kritiker warfen den Entscheidungsträgern vor, zu schnell und ohne tiefere Debatte gehandelt zu haben.
Gegner des Erhalts verwiesen auf die ästhetische Fremdheit des Baus im historischen Umfeld und auf die hohen Kosten einer zweifelsohne notwendigen Sanierung. Der Abriss wurde so zu einem Sinnbild für den oftmals radikalen Umgang mit der DDR-Architektur in den 1990er Jahren – und die darauf folgenden kontroversen Diskussionen um den Umgang mit dem Erbe der DDR-Moderne.
Erinnerungskultur am Schlossplatz: Was bleibt vom DDR-Außenministerium?
Heute erinnert am Schlossplatz nichts mehr direkt an das einstige Außenministerium der DDR. Stattdessen prägt das wiedererrichtete Berliner Schloss das Bild des Ortes. Das Spannungsfeld zwischen Rekonstruktion historischer Formen und dem Verlust jüngerer Baugeschichte zeigt sich hier besonders deutlich.
In der Debatte um Erinnerungskultur fordern immer wieder Stimmen, auch an das Außenministerium sichtbar zu erinnern. Ob dies in Form einer Gedenktafel, eines künstlerischen Zeichens oder durch digitale Rekonstruktionen geschieht, ist bis heute offen. Ein Erinnern jedoch soll es geben. So forderte 2022 etwa die Präsidentin der Berliner Architektenkammer, Theresa Keilhacker, in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung: „Unabhängig davon, ob sich im Untergrund solche Spuren finden lassen, sollte aber bei der künftigen Bebauung auch an das DDR-Außenministerium erinnert werden.“
Die von Keilhacker angesprochene Bebauung meint natürlich den geplanten Wiederaufbau der Schinkelschen Bauakademie, die an dieser Stelle realisiert werden soll. Unabhängig davon, ob eine Erinnerung an das einstige Auswärtige Amt in irgendeiner Form erfolgen wird, bleibt eines unbestritten: Der Bau bleibt ein Symbol für die kurze, widersprüchliche Geschichte der DDR-Architektur in der Mitte Berlins.
Das Gebäude bestand aus einem Hochhausblock und einem niedrigeren Trakt, verbunden durch eine klar strukturierte Anlage. Großzügige Konferenzräume, moderne Büros und ein repräsentatives Foyer unterstrichen den Anspruch, an dieser exponierten Stelle im Zentrum Ost-Berlins internationale Diplomatie auf Augenhöhe zu betreiben. / © Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-1987-0316-311 / CC-BY-SA 3.0
Besonders auffällig war die Aluminiumfassade, die dem Gebäude eine metallisch schimmernde Präsenz verlieh. Sie sollte Fortschritt und Internationalität symbolisieren, zugleich aber auch Dauerhaftigkeit ausstrahlen. / © Foto: IMAGO, Jürgen Ritter
Seltene Aufnahme: Das ehemalige Auswärtige Amt der DDR im September 1993 neben der Schlossattrappe. Kurze Zeit später wurde das Gebäude abgerissen. / © Foto: IMAGO, Stana
© Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-L0927-0305 / CC-BY-SA 3.0
Anzeige
Quellen: Deutsches Architektur Forum, IMAGO, Wikimedia Commons, Architektur Urbanistik Berlin, berlin.de, Deutsches Historisches Museum, Wikipedia, Architektur Urbanistik Berlin, bodenschatz.berlin, Berliner Zeitung, Orte der Einheit, archINFORM