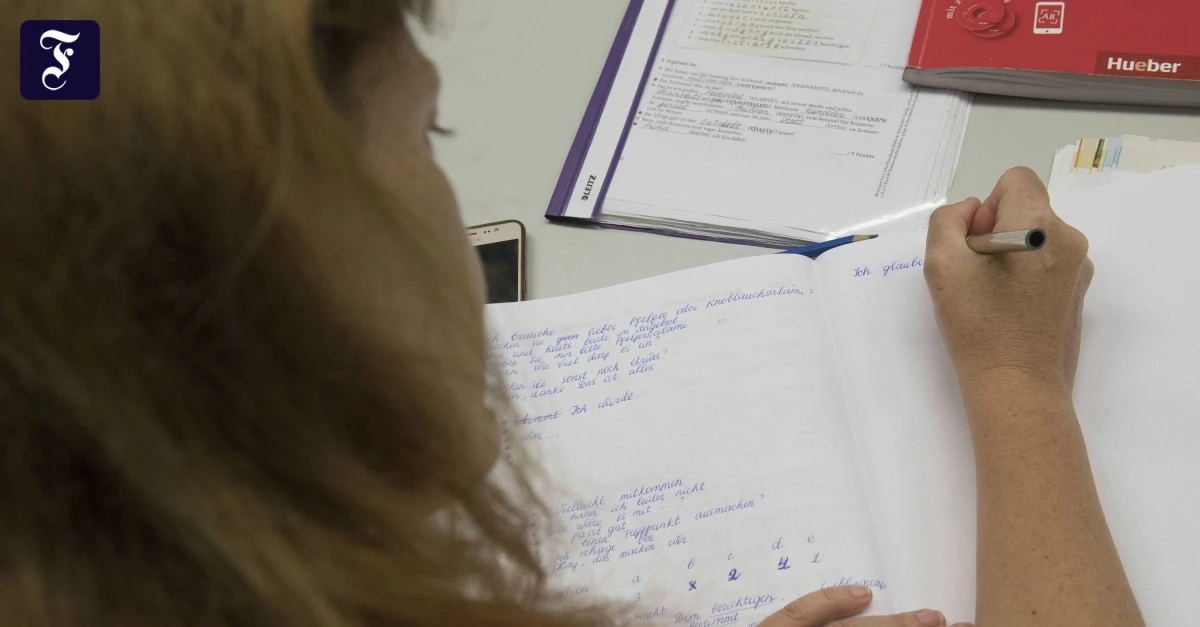Im Februar 2023 ist Rostyslaw Kowaljow in einen Bus gestiegen. Er wollte raus aus seiner Stadt, die Nacht für Nacht unter russischem Beschuss stand. Die Fahrt führte ihn von Odessa nach Deutschland. Ein Jahr nach dem Großangriff war er noch geblieben, um seinen Schulabschluss zu machen. Seine Eltern wollten das so. Dann musste es aber schnell gehen. Nach seinem 18. Geburtstag hätte er die Ukraine wegen des Kriegsrechts nicht mehr verlassen dürfen.
Seit zweieinhalb Jahren lebt der mittlerweile Zwanzigjährige nun in Erfurt. Dort ist er anfangs bei Freunden seiner Eltern untergekommen. Im Oktober wird er sein Informatikstudium in Jena beginnen. Der Weg dahin war nicht leicht. Bei seiner Ankunft in Erfurt konnte Kowaljow kein Wort Deutsch. Er besuchte Deutschkurse, doch für mehr als Sprachniveau B 1 erhielt er vom deutschen Staat keine Förderung. Um sein Studium beginnen zu dürfen, braucht er aber Niveau C 1. Ein privater Kurs? Für ihn unbezahlbar. Seine Arbeit an der Supermarktkasse reicht gerade zum Leben.
Mit wenig Geld und viel Disziplin bereitete Kowaljow sich auf die C 1-Prüfung vor. Kein Lehrer half ihm, es gab keine Mitschüler, mit denen er lernen konnte. Er hatte nur ein Deutschbuch, mit dem er Abend für Abend lernte. Dazu Onlinebekanntschaften, mit denen er Deutsch sprach. Im zweiten Anlauf bestand er die Prüfung.
Sie will eine Ausbildung machen
Bei Diana Chelidze hat es zwei Jahre gedauert, bis sie überhaupt einen Deutschkurs besuchen konnte. Das lag nicht an ihr. Das Jobcenter verwies auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das mit einer Antwort sehr lange auf sich warten ließ. Die Entscheidung, wer welchen Sprachkurs bezahlt bekommt, liegt beim Jobcenter im jeweiligen Ort, die Sprachkurse selbst werden aber vom BAMF konzipiert und auch finanziert. Was genau schiefgelaufen ist, weiß Chelidze selbst nicht. Aber immerhin: Seit diesem Sommer besucht sie an fünf Tagen in der Woche den A 2-Kurs in Frankfurt.
Nebenbei arbeitet Chelidze als Küchenhilfe in Restaurants. Egal, ob zuerst in einem kleinen Dorf in Osthessen oder heute in Frankfurt: Sie arbeitet vor allem mit anderen Ausländern zusammen. Afghanen, Pakistaner, Syrer, aber auch eine Menge Ukrainer. „Deutsch lernt man da eher nicht“, meint sie, „höchstens Ausländerdeutsch.“ Deswegen ist sie auch so glücklich über den Kurs, weil sie jetzt endlich richtig Deutsch lernen kann, wie sie sagt. Sie möchte nämlich nicht für immer in der Gastronomie bleiben.
Chelidzes Traum ist ein anderer. Sie würde gerne eine Ausbildung machen, vielleicht als Krankenschwester oder in einer Bank. So ganz sicher ist sie sich noch nicht. Was genau sie arbeiten wird, ist ihr auch nicht so wichtig. Es sollte nur Spaß machen und besser sein als die Arbeitszeiten und das Geld in der Gastronomie. Sie ist erst 22 und kann sich noch ein wenig ausprobieren.
Hochqualifizierte haben es schwerer
Olha Myrzalo steht an einem anderen Punkt im Leben. Mit 53 Jahren blickt sie schon auf Jahrzehnte an Arbeitserfahrung zurück. Als junge Frau studierte sie Journalismus in den USA, kam dann zurück in die Ukraine und arbeitete in der amerikanischen Botschaft in Kiew.
Der Krieg veränderte alles. Zusammen mit ihrem Kind kam sie nach Frankfurt. Als die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Krieges zerstoben, traf sie dem Kind zuliebe eine Entscheidung. Obwohl ihr damaliger Arbeitgeber, die amerikanische Entwicklungshilfeagentur USAID, ihre Leute ein Jahr nach dem Großangriff nach Kiew zurückbeorderte, blieb sie in Deutschland. Damit war auch klar, dass sie sich beruflich neu orientieren musste.
Myrzalo würde gerne ihren Qualifikationen entsprechend arbeiten. In Kiew verantwortete sie die ukrainische Öffentlichkeitsarbeit von USAID. In Deutschland hat das Jobcenter ihr eine Arbeit als Rezeptionistin in einem Hotel vorgeschlagen. „Nicht dass das keine gute Arbeit ist“, sagt sie, „aber ich denke, ich könnte Deutschland nützlicher sein in einer Arbeit, die meinen Fähigkeiten entspricht.“ Sie findet, dass in der derzeitigen Diskussion über die Ukrainer hier Frauen wie sie untergehen.
Viele arbeiten als Reinigungskräfte und Küchenhilfen
Ähnlich sieht es das Institut für Arbeits- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB). In einem Bericht von diesem Jahr ist die Rede von „ungenutzten Potentialen“ bei den Ukrainern, und das besonders bei den Frauen. Unter denen, die schon eine Arbeit gefunden haben, üben 57 Prozent Tätigkeiten aus, die unterhalb des Niveaus ihres letzten Jobs im Heimatland liegt. Am häufigsten arbeiten Flüchtlinge als Reinigungskräfte – gefolgt von Küchenhilfen. Auch das IAB hält fest, dass bei Hochqualifizierten die Integration länger dauert.
Das kann Myrzalo aus eigener Erfahrung bestätigen. In Berufen, die sie reizen, werden Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau C 1 erwartet, wenn nicht sogar C 2. Ein solcher Kurs wird – wie im Fall des angehenden Informatikstudenten Kowaljow – nicht gefördert. Der Integrationskurs, den alle machen müssen, endet mit B 1, darüber hinaus gibt es eine Förderung nur noch für bestimmte Berufsgruppen. Welche das sind, hängt vom Ermessen des jeweiligen Jobcenters ab. Myrzalo wünscht sich da von den deutschen Behörden ein bisschen mehr Flexibilität.
Um schnell möglichst gutes Deutsch zu lernen, helfen Gespräche mit Tiefgang. Dafür müsste man hier Freunde finden. Diana Chelidze und Rostyslaw Kowaljow berichten, das sei schwierig. Außerhalb der Arbeit gebe es wenig Kontakt mit Deutschen. Bei der Arbeit seien es meistens andere Ausländer, mit denen man zusammenarbeite.
Kowaljow nimmt aber auch die eigene Community in die Pflicht. „Einige nutzen die Möglichkeiten nicht so gut, wie sie könnten“, sagt er über ein paar seiner ukrainischen Freunde hier. Die eine Hälfte würde „nichts machen“ und hätte auch in drei Jahren immer noch kein Deutsch gelernt. Die andere Hälfte hingegen arbeite oder mache eine Ausbildung.
Beschäftigungsquote niedrig
Es geht auch das Gerücht um, dass man als Ukrainer in die Heimat zurückkehren, aber trotzdem noch Bürgergeld beziehen könnte. Die Bundesagentur für Arbeit will das auf Anfrage so nicht bestätigen. Ein systematischer Leistungsmissbrauch von Ukrainern sei nicht bekannt. Jede Person, die Leistungen von Jobcentern beziehe, müsse erreichbar sein. Wenn eine Person längere Zeit, höchstens drei Wochen im Kalenderjahr, nicht erreichbar sei, also nicht auf Aufforderung oder Schreiben des Jobcenters reagiere, würden die Leistungen aufgehoben.
Nirgends sonst in Europa ist der Anteil ukrainischer Flüchtlinge, die arbeiten, so gering wie in Deutschland. In Polen und in der Tschechischen Republik ist die Lage anders. Dort arbeitet die Mehrheit von ihnen. Die Sprache ist für Ukrainer leichter zu lernen, und es gibt keine mit dem Bürgergeld vergleichbaren Leistungen. Auch in Deutschland gab es zuletzt aber Fortschritte. Im Juni lag die Beschäftigungsquote bei ukrainischen Flüchtlingen bei 35 Prozent. Ein Jahr zuvor arbeiteten nur 28 Prozent von ihnen.
Trotz aller Schwierigkeiten ist eines klar: Die meisten der gut 1,3 Millionen ukrainischen Flüchtlinge hier dürften so bald nicht in ihre Heimat zurückkehren. Ein Frieden ist nicht in Sicht. Und selbst wenn der Krieg eines Tages vorbei sein sollte, dürften sich gerade viele junge Menschen, die sich in Deutschland etwas aufgebaut haben, die Frage stellen, ob sie nun schon wieder neu anfangen wollen.