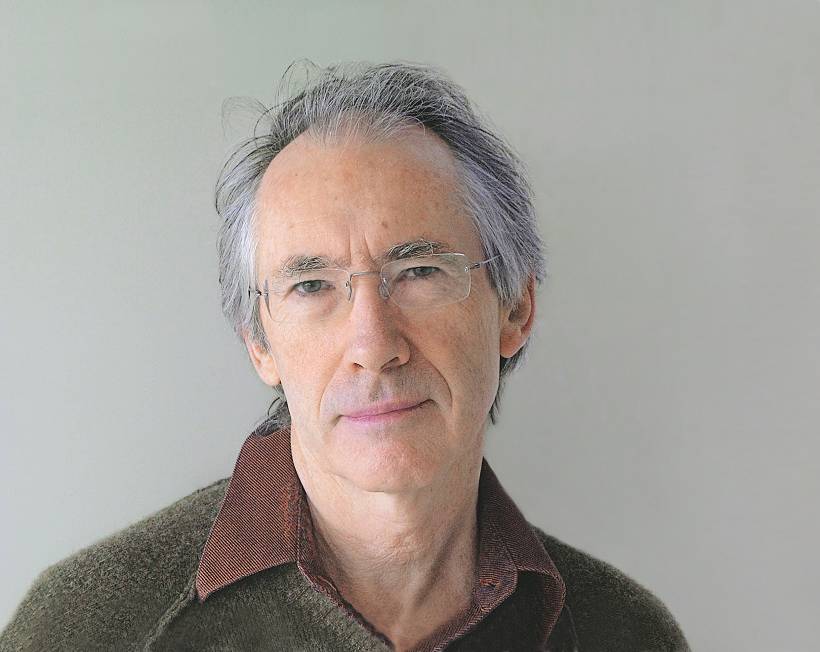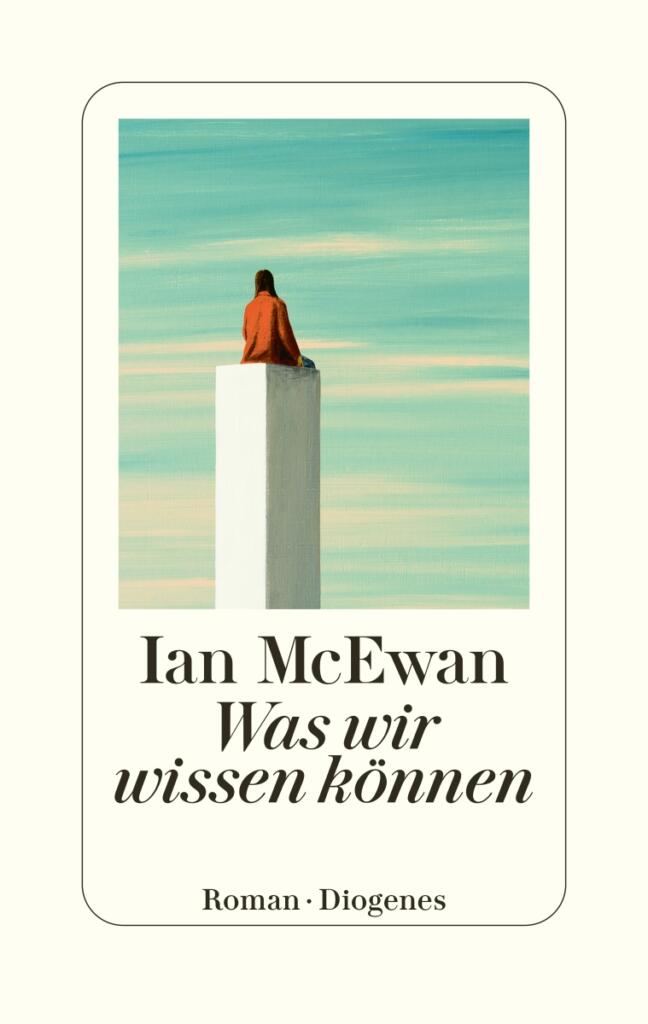Mit „Was wir wissen können“ schickt uns Ian McEwan eine Botschaft aus der Zukunft und bewirbt sich erneut um den Literaturnobelpreis
von Gérard Otremba
„Die mächtige Vergangenheit setzt der Gegenwart so schwer zu wie Meer, Wind und Regen dem Kreidefelsen“. Die Gegenwart in Ian McEwans Roman „Was wir wissen können“ befindet sich in unserer Zukunft. Und es steht nicht gut um die Erde in circa 100 Jahren. Diverse Kriege und eine Flutkatastrophe haben die Bevölkerungszahl unseres Planeten halbiert, Großbritannien besteht nur noch aus einzelnen kleinen Inseln, in den USA herrschen Warlords über die Geschicke des Landes, während Nigeria zu einem führenden Land aufgestiegen ist. Den Wissenschaftlern steht ein großes Archiv über die Vergangenheit zur Verfügung, und einer von ihnen, der britische Literaturdozent Tom Metcalfe, steht im Mittelpunkt eines, nach dem 2023 veröffentlichten „Lektionen“, erneut großartigen Werks des 77-jährigen Briten.
Ein verschollenes Gedicht
Ian McEwan erzählt im ersten, etwas mehr als die Hälfte des Romans einnehmenden Teil aus der Perspektive Metcalfs, der sich mit akribischer Besessenheit auf die Suche nach einem verschollenen Gedicht des in unserer Zeit berühmten Lyrikers Francis Blundy macht. Metcalf arbeitet in der wissenschaftlichen Abteilung „Englische Literatur 1990-2030“ und verfügt aufgrund des einsetzenden „Digitalen Zeitalters“ über „mehr Fakten und Interpretationsmöglichkeiten, als sich in einem Dutzend Leben erläutern ließen“. Die Leben des Dichters Francis Blundy und seiner Frau Vivien haben es ihm aber soweit angetan, dass er einen detaillierten Bericht aus den ihm vorliegenden Materialien wie Briefe, Tagebücher, SMS und Social Media („Alles, was je durchs Internet strömte, ist wohlbehütet in Neu-Lagos gespeichert und wurde längst katalogisiert“) schreibt.
Francis Blundy trug das Gedicht „Sonettenkranz für Vivien“ nur ein einziges Mal im Rahmen einer Geburtstagsfeier seiner Frau im Jahr 2014 vor. Mythenumrankt ward es danach ward es nie wieder gesichtet. Mit Hilfe seiner Partnerin Rose sucht Tom Metcalfe nach allen erdenklichen Spuren, die ihn zum Gedicht-Manuskript führen könnten und beide bald auf eine abenteuerliche Reise schicken.
Der mahnende Ian McEwan
Im zweiten Abschnitt von „Was wir wissen können“ springt Ian McEwan in die Zeit zurück und lässt Vivien Blundy zu Wort kommen. Die aus ihrer Sicht nicht nur den Abend des Gedichtvortrags, sondern die ganze, bis zu einem Kriminalfall reichende Geschichte um sich und ihren Ehemann erzählt. Eine neue Perspektive, die einiges der Tom Metcalf bekannten Geschichtsschreibung in ein ergänzendes und auch anderes Licht rückt. Ian McEwan zeichnet in „Was wir wissen können“ ein erschreckend vorstellbares Zukunftsszenario. Ausgehend und geprägt von den jetzigen Bedrohungen (russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, Vormarsch autoritärer Machthaber, Klimawandel, etc.) leben seine Protagonisten in einer Welt, die jeder halbwegs normal denkende Mensch verhindern möchte.
Aber seine Hauptfigur Tom Metcalf bleibt trotz der Katastrophen optimistisch und sieht Chancen für die Zukunft („Permanente Zerstörung. Permanente Neuerfindung … Die Fähigkeit zu lesen wird überdauern, zumindest bei einigen wenigen“). Eine mahnende, wichtige und faszinierende, von Ian McEwan literarisch perfekt ins Szene gesetzte Botschaft aus der Zukunft. Nach „Abbitte“, „Saturday“ und „Kindeswohl“ bewirbt sich Ian McEwan mit mindestens dem vierten Roman um den Literaturnobelpreis.
Ian McEwan: „Was wir wissen können“, Diogenes, übersetzt von Bernhard Robben, Hardcover, 480 Seiten, 978-3-257-07357-7, 28 Euro (Beitragsbild: Ian McEwan von Annalena McAfee)
von Gérard Otremba
Jahrgang 1969. Selbständiger Journalist und als Chefredakteur verantwortlich für den Inhalt von Sounds & Books. Muss mit Sounds & Books Geld verdienen, um seine Miete bezahlen zu können. Begann seine journalistische Karriere in den 90ern für die Frankfurter Musikzeitschrift Kick’n’Roll, bevor er einige Jahre als freier Mitarbeiter für die Frankfurter Rundschau tätig war. Seit 2010 Online-Veröffentlichungen. Rezensent beim Rolling Stone-Magazin. Autor der Schriften „Die geheimen Aufzeichnungen des Buchhändlers“ sowie „Ein weiterer Tag im Leben des Buchhändlers“. Großer Bewunderer der Musik von The Beatles, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young, Van Morrison, Wilco, Nick Cave und Element Of Crime. Sympathisant des FC St. Pauli, Marathonläufer. Lebensmotto: „Rock’n’Roll Can Never Die“.