Eine „hinkende Union“ sei den europäischen Staats- und Regierungschefs da gelungen, befand Günther Nonnenmacher nach der Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht am 7. Februar 1992 in der F.A.Z. Sie hatten die Europäische Währungsunion mit unabhängiger Zentralbank und strikten Regeln zur Höhe der Haushaltsdefizite und der Verschuldung der Mitgliedstaaten auf den Weg gebracht. Aber ein demokratisch legitimiertes wirtschaftspolitisches Entscheidungszentrum fehlte. In der Außen- und Verteidigungspolitik blieb es bei vagen Zukunftsversprechungen. Grundsätze der Sozialpolitik wurden in einem gesonderten Abkommen festgelegt, dem Großbritannien nicht beitrat; ihre Umsetzung blieb von Voten des Ministerrats abhängig, die teilweise auch Einstimmigkeit erforderten.
Viktor Jaeschke stellt den Vertrag von Maastricht in den Kontext der Zielsetzungen, Hoffnungen und Befürchtungen von vier Hauptakteuren: der Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Kommission unter der Präsidentschaft von Jacques Delors. Er bündelt sie unter dem Begriff der Imaginäre, die den Unionsbegriff unterschiedlich auslegten und folglich zu einem Verhandlungsergebnis führten, das starke Ambivalenzen aufwies.
Für Frankreich konstatiert Jaeschke eine Hoffnung auf ein starkes Machtzentrum, das in der Weltpolitik unabhängig agierte und nach französischem Vorbild von einer starken Exekutive geführt wurde. Als solche sollte der Europäische Rat fungieren, eine Art „kollektiver Staatschef“, bei dem das Hoffen auf Effektivität und das Beharren auf nationaler Souveränität in einem unaufgelösten Widerspruch standen. Perspektivisch sollte dieser wohl durch die Einführung von Mehrheitsvoten im Rat aufgelöst werden, aber das blieb vorerst eine Zukunftsvision. Die Währungsunion, die zur Sicherung der Unabhängigkeit von US-amerikanischer Willkür wie zur Eindämmung deutscher Macht für notwendig erachtet wurde, sollte durch eine europäische Wirtschaftsregierung ergänzt werden, bei der wiederum dem Europäischen Rat die entscheidende Rolle zufallen sollte. Schließlich sollte der Binnenmarkt durch die Festlegung sozialer Mindeststandards eingehegt werden.
Die Bundesregierung setzte hingegen, auch sie nach eigenem Vorbild, auf eine Aufwertung des Europäischen Parlaments, ergänzt durch eine stärkere Einbindung der Regionen in den europapolitischen Entscheidungsprozess. Hinsichtlich der Währungsunion beharrte sie auf dem deutschen Modell einer Unabhängigkeit der Zentralbank und der Verpflichtung auf feste Regeln zur Staatsverschuldung und zum Haushaltsdefizit. Den Binnenmarkt wollte sie ebenfalls sozial abfedern. Hinsichtlich der Außen- und Verteidigungspolitik verband sie ambitionierte Zielsetzungen mit vorsichtigem Vorgehen ein Schritt nach dem anderen. Eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität konnte für sie nur im Ausbau eines „europäischen Pfeilers“ der NATO zum Ausdruck kommen.
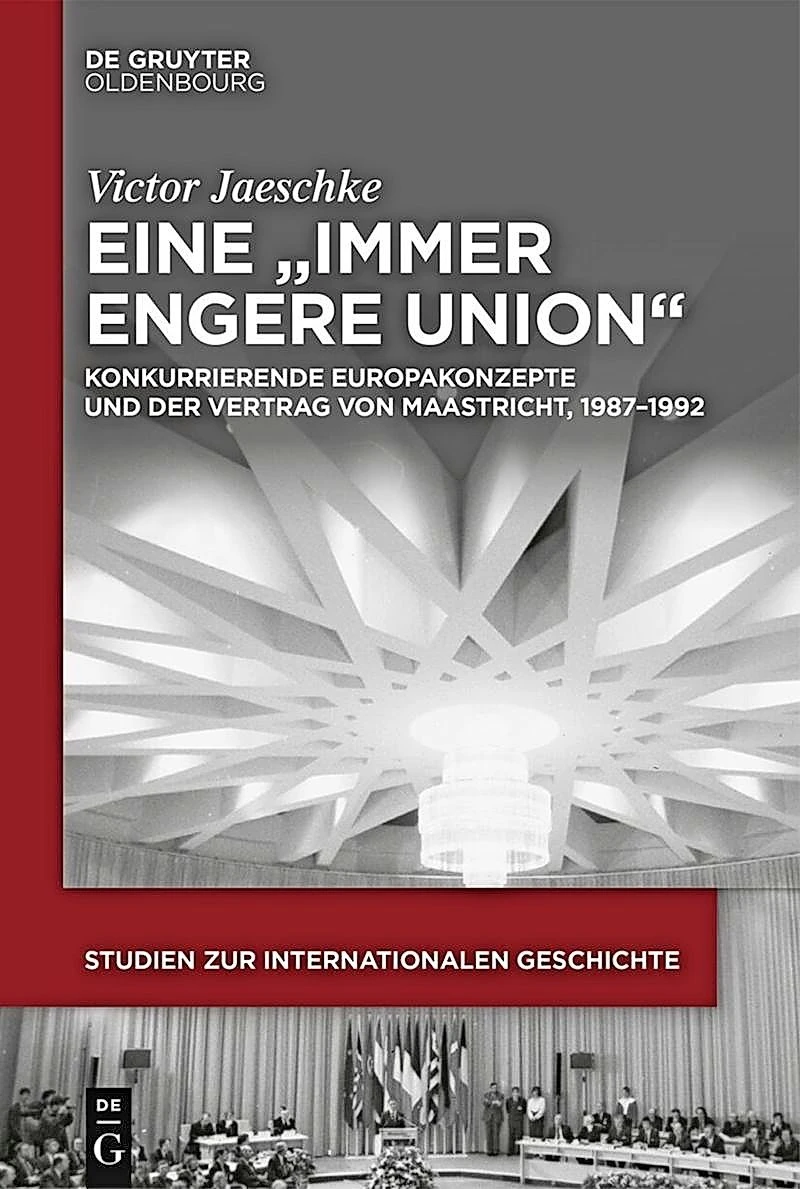 Verlag
Verlag
Für die britische Regierung war die Schaffung der Europäischen Union identisch mit der Vollendung des Binnenmarktes. „Das ist unsere Show“, erklärte John Major, damals kurzzeitig Außenminister, im Oktober 1989 auf dem Parteitag der Konservativen. „Die Gemeinschaft setzt unser Programm um.“ Alles andere, ob Währungsunion, Sozialunion, Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik, eine Aufwertung des Europäischen Parlaments oder eine Stärkung der Europäischen Kommission, lehnte sie als Einschränkung der nationalen Souveränität und Übergang zu einem europäischen „Superstaat“ ab. Dabei nutzte sie das Subsidiaritätsprinzip, das die Kommission und die Bundesregierung zur Begründung supranationalen Regierens eingeführt hatten, zur Forderung nach Rückverlagerung von Gemeinschaftsaufgaben auf die nationale Ebene.
Ganz im Gegensatz dazu verstand sich die Europäische Kommission als Nukleus einer künftigen europäischen Regierung, der nach föderalistischem Ideal das Parlament und der Ministerrat als gleichberechtigte Legislativorgane gegenüberstanden. Über die bisherigen Aufgaben hinaus sollte sie insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus engagierte sich Delors ebenfalls für die Wirtschaftsregierung und die verbindliche Festlegung von Sozialstandards. Auch sie sollten in den Zuständigkeitsbereich der Kommission fallen.
All das ist im Grundsatz bekannt. Was Jaeschke auf der Grundlage vermehrter Auswertung interner Quellen zusätzlich bietet, ist der Nachweis der Ängste, die die Spitzenakteure in besonderem Maße umtrieben. So befürchtete der britische Schatzkanzler Nigel Lawson, die Wirtschafts- und Währungsunion würde „nicht weniger als eine europäische Regierung, wenn auch eine föderale, und politische Union bedeuten: die Vereinigten Staaten von Europa“. Das sei „mit unabhängigen souveränen Staaten mit Kontrolle ihrer eigenen Fiskal- und Währungspolitik unvereinbar“.
Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand fürchtete nach der ersten Aufregung über ein mögliches Ausscheiden eines wiedervereinigten Deutschlands aus dem Unionsprojekt, die britische Regierung könne die Beitrittswünsche der osteuropäischen und neutralen Staaten dazu nutzen, die angestrebte Vertiefung der Europäischen Gemeinschaft erst einmal auf Eis zu legen. Die Furcht war so groß, dass er in seiner Neujahrsansprache am 31. Dezember 1989 die Idee einer unverbindlichen „Europäischen Konföderation“ lancierte, ohne sich selbst mit seinen engsten Beratern abgesprochen zu haben. Der Vorstoß, der die Beitrittswilligen erst einmal in einen Wartesaal verweisen sollte, fiel entsprechend diffus aus, und er verpuffte ohne jede Wirkung.
Bundeskanzler Helmut Kohl beschwor die Bundestagsfraktion der CDU/CSU angesichts der nationalen Töne, die nach dem Mauerfall aufkamen, es sei „ungeheuer wichtig, dass wir uns jetzt nicht in eine Ecke drängen lassen […]: Erst Deutschland und dann Europa, sondern dass es heißen muss: Deutschland und Europa oder Europa und Deutschland.“ Zur Begründung fügte er hinzu: „Das ist übrigens klassische Adenauersche Politik.“
In der Tat liegt im Festhalten an der wechselseitigen Instrumentalisierung von deutscher Wiedervereinigung und europäischer Einigung das Hauptverdienst Kohls in der Umbruchphase 1989/90. Dass dazu ganz zentral die prinzipielle Zustimmung zur Währungsunion gehörte, ohne über die Akzeptanz der deutschen Bedingungen für diese Union Gewissheit zu haben, wird in Jaeschkes Darstellung nicht deutlich genug herausgearbeitet. Ansonsten bietet sie ein abgewogenes und verlässliches Bild der Europa-Vorstellungen im weltpolitischen Umbruch der Gorbatschow-Ära.
Viktor Jaeschke: Eine „immer engere Union“. Konkurrierende Europakonzepte und der Vertrag von Maastricht, 1987–1992. De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2025. 365 S., 79,95 €.
